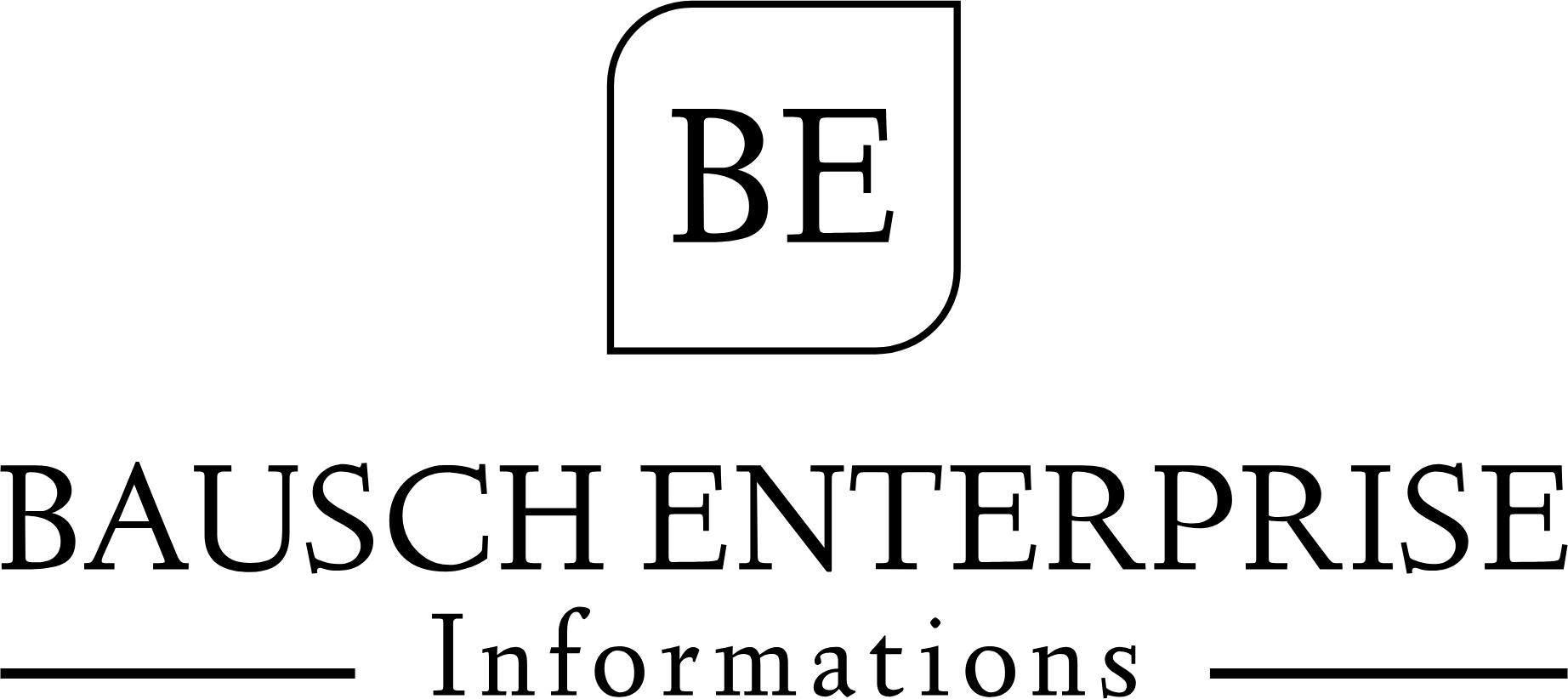Zwischen politischem Anspruch und ökonomischer Realität. Warum Millionen Verträge scheitern mussten – und wie Verbraucher aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können.
Die Riester-Rente war einst das große Reformprojekt der deutschen Rentenpolitik. Eingeführt 2002 vom damaligen Bundesarbeitsminister Walter Riester, sollte sie die Lücken schließen, die durch die Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus entstanden. Der Staat versprach Zulagen, Steuervorteile und Sicherheit. Millionen Bürger folgten dem Aufruf – doch heute, im Jahr 2025, gleicht die Riester-Rente einem Scherbenhaufen. Mehr als fünf Millionen der insgesamt rund 20 Millionen Verträge wurden bereits gekündigt. Allein zwischen Januar und August 2025 kamen fast 220.000 Kündigungen hinzu. Damit ist jeder vierte Vertrag mittlerweile beendet – und das einstige Leuchtturmprojekt droht endgültig zur größten Enttäuschung der privaten Altersvorsorge zu werden.
Die zentrale Frage lautet: Warum ist ein Modell, das mit so viel Hoffnung und staatlicher Förderung startete, derart gescheitert? Und noch wichtiger: Welche Lehren lassen sich daraus für die Zukunft ziehen, um Millionen Verbraucher vor ähnlichen Enttäuschungen zu bewahren?
Die Idee hinter Riester – Sicherheit als Verkaufsargument
Die Grundidee war einfach: Wer privat zusätzlich vorsorgt, soll staatliche Unterstützung erhalten. Kern war die Beitragsgarantie: Zum Rentenbeginn sollte mindestens das eingezahlte Kapital inklusive Zulagen zur Verfügung stehen. Ein Versprechen, das Sicherheit suggerierte, aber ökonomisch zur großen Schwäche wurde.
Denn Sicherheit bedeutet in der Finanzwelt fast immer: niedrige Renditen. Versicherer und Banken mussten die Gelder konservativ anlegen, überwiegend in festverzinslichen Anleihen. In Zeiten sinkender Zinsen – 2023 erreichte der Einlagenzins der EZB seinen Zenit und lag lange auf Niedrigniveau – konnte diese Kapitalanlage schlicht keine nennenswerten Erträge erwirtschaften.
Prof. Dr. Philipp Schade, unabhängiger Aktuar, bringt es auf den Punkt: „Die Mathematik ist unbestechlich. Wenn der Garantiezins bei 0,25 Prozent liegt und gleichzeitig Abschlusskosten, Verwaltungskosten und Vertriebsprovisionen in Höhe von zwei bis drei Prozentpunkten (bezogen auf die Rendite) pro Jahr anfallen, ist die Rechnung eindeutig: Die Rendite für den Kunden bleibt negativ.“
Mit anderen Worten: Was als Sicherheit verkauft wurde, entpuppte sich als Renditekiller.
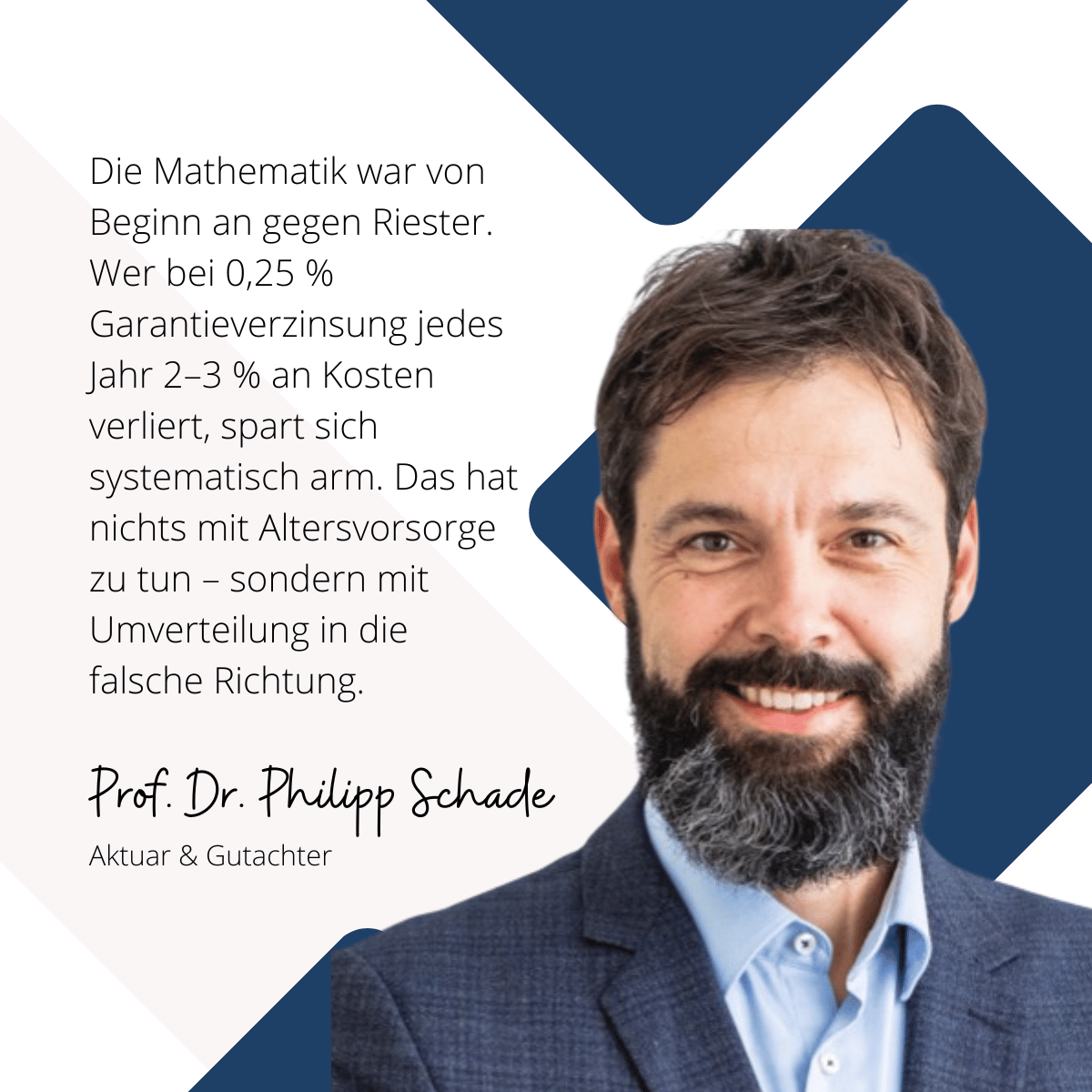
Hohe Kosten – das zweite Standbein des Scheiterns
Neben der mageren Verzinsung war es vor allem die Kostenstruktur, die Riester zum Problem bereitete. Abschlussprovisionen, Vertriebskosten und laufende Verwaltungskosten summierten sich häufig auf mehrere tausend Euro. Selbst in guten Kapitalmarktzeiten war es schwer, diese Kosten auszugleichen. Was viele nicht wissen: Selbst die staatlichen Zulagen betrachten die Versicherer als Zusatzbeitrag für den Vertrag und berechnen darauf üppige Abschlusskosten (bis ca. 8,5 Prozent der Zulage waren nicht unüblich). So wurden steuerfinanzierte Zulagen zu versteckten Subventionen für die Versicherungswirtschaft.
Sven Enger, ehemaliger Vorstand mehrerer Versicherungsunternehmen und heute Geschäftsführer der auxinum GmbH, erklärt: „Das System war von Anfang an ein Ungleichgewicht. Verbraucher vertrauten darauf, dass die staatliche Förderung die Nachteile ausgleicht. Doch am Ende profitierten vor allem die Versicherer, weil hohe Kostenstrukturen festgeschrieben waren. Für den Verbraucher blieb kaum etwas übrig.“
Ein Beispiel macht das Problem deutlich: Wer über 20 Jahre hinweg 100 Euro monatlich in einen Riester-Vertrag einzahlte, zahlte insgesamt 24.000 Euro ein. Durch Kosten und niedrige Verzinsung lag das Vertragsguthaben am Ende in vielen Fällen unter dieser Summe – trotz staatlicher Zulagen.
Intransparenz und Komplexität – Hürden statt Hilfe
Die Riester-Rente litt zudem unter einer Bürokratie, die viele Verbraucher überforderte. Jährliche Einkommensprüfungen, komplizierte Zulagenberechnungen und steuerliche Sonderregeln machten das Produkt zu einem Bürokratiemonster. Viele Förderberechtigte beantragten die Zulagen erst gar nicht oder verloren sie, weil sie formale Anforderungen nicht erfüllten.
Für Juristen ist diese Komplexität besonders brisant: Ein Vorsorgeprodukt, das mit Verbraucherschutz wirbt, darf nicht so intransparent sein, dass Verbraucher ihre Rechte nicht verstehen oder verlieren. Hier stellt sich die Frage, ob die Branche mit der Konstruktion bewusst eine Überforderungssituation schuf – ein möglicher Ansatzpunkt für Klagen wegen Falschberatung oder unzureichender Aufklärung.
Zahlen, die für sich sprechen
Die nackten Zahlen sprechen eine Sprache, die kaum deutlicher sein könnte – und sie ist für viele Verbraucher ernüchternd. Seit der Einführung der Riester-Rente wurden von insgesamt 20 Millionen abgeschlossenen Verträgen mehr als 5 Millionen vorzeitig gekündigt. Das bedeutet: Jeder vierte Vertrag wurde beendet, häufig aus Frust über hohe Kosten, enttäuschende Renditen oder intransparente Bedingungen. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 kamen weitere 220.000 Kündigungen hinzu – ein neuer Negativrekord, der zeigt, dass die Geduld der Sparer endgültig erschöpft ist. Offiziell laufen zwar noch 15,5 Millionen Verträge, doch ein erheblicher Teil davon wird längst nicht mehr aktiv bespart. Viele Versicherungsnehmer halten ihre Policen nur noch passiv, in der Hoffnung, wenigstens das eingezahlte Kapital am Ende zurückzubekommen.
Noch deutlicher wird die Schieflage, wenn man die Renditen betrachtet. 2024 lag die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen der Versicherer bei 2,37 Prozent. Was auf den ersten Blick nach Stabilität aussieht, entpuppt sich im Kontext der Realität als Verlustgeschäft: Bei einer Inflationsrate von über 3 Prozent bedeutet dies für die Kunden ein reales Minus. Mit anderen Worten: Das Geld, das sie über Jahre und Jahrzehnte in ihre Verträge einzahlen, verliert unaufhaltsam an Kaufkraft.
Juristisch und ökonomisch wirft das eine fundamentale Frage auf: Wie tragfähig ist ein Modell, das Millionen Menschen zur privaten Vorsorge animiert, aber faktisch nicht in der Lage ist, deren Vermögen real zu sichern oder gar zu vermehren? Ist es noch mit dem Gedanken des Verbraucherschutzes vereinbar, wenn ganze Generationen von Sparern erkennen müssen, dass sie trotz jahrzehntelanger Einzahlung am Ende schlechter dastehen als zuvor?

Die Frühstartrente – Lösung oder Symbolpolitik?
Ab 2026 will die Bundesregierung mit der sogenannten Frühstartrente einen neuen Anlauf für die private Altersvorsorge wagen. Die Idee klingt auf den ersten Blick bestechend einfach: Jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren soll monatlich zehn Euro vom Staat in ein spezielles Altersvorsorgedepot eingezahlt bekommen. Frühzeitig sparen, Kapital über Jahrzehnte wachsen lassen und damit die Rentenlücke verringern – so lautet das Versprechen.
Doch Finanzexperten von Finanztip haben kürzlich veröffentlicht, dass genau dieses Modell kaum mehr sei als Symbolpolitik. Rechnet man nüchtern nach, zeigt sich die ganze Schwäche des Konzepts: Zehn Euro im Monat ergeben über einen Zeitraum von zwölf Jahren lediglich 1.440 Euro. Selbst wenn man optimistisch eine jährliche Rendite von 5 Prozent zugrunde legt, wächst das Guthaben bis zum Renteneintritt kaum zu einer relevanten Altersvorsorge an. Im Verhältnis zu den tatsächlichen Rentenlücken, die sich laut Berechnungen häufig im sechsstelligen Bereich bewegen, wirkt dieses Vorhaben wie ein Tropfen auf den sprichwörtlich heißen Stein.
Diese Einschätzung verdeutlicht, dass die Politik mit kleinen Gesten zwar Schlagzeilen erzeugen kann, die großen Baustellen der privaten Altersvorsorge jedoch ungelöst bleiben. Für Juristen stellt sich die drängende Frage, ob der Staat mit solchen Maßnahmen seiner Verantwortung zur Schaffung eines fairen, transparenten und zukunftsfähigen Systems tatsächlich nachkommt – oder ob er lediglich Erwartungen weckt, die am Ende zwangsläufig enttäuscht werden.
Lehren für die Zukunft – Transparenz und Fairness als Schlüssel
Aus dem Scheitern der Riester-Rente müssen Politik und Versicherungsbranche dringend Konsequenzen ziehen. Transparenz, niedrige Kosten und flexible Produkte sind keine optionalen Zusatzmerkmale, sondern die Grundbedingungen für eine funktionierende private Altersvorsorge.
Prof. Dr. Schade betont: „Es braucht klare Regeln, die Kosten auf maximal 0,5 Prozent pro Jahr deckeln und die Produkte für den Verbraucher nachvollziehbar machen. Ohne diese Reformen wird jedes neue Modell an denselben Fehlern scheitern.“
Sven Enger ergänzt aus seiner Erfahrung: „Sicherheit und Rendite müssen getrennt gedacht werden. Wer Sicherheit will, soll sie bekommen – aber ehrlich und ohne falsche Renditeversprechen. Wer Rendite sucht, benötigt transparente, kostengünstige und flexible Produkte.“
Fazit – das Ende einer Illusion, der Anfang einer Reform?
Die Riester-Rente steht sinnbildlich für das Spannungsfeld zwischen politischem Anspruch und ökonomischer Realität. Millionen Verbraucher sind enttäuscht, Milliarden an Beiträgen haben kaum Rendite erwirtschaftet, und das Vertrauen in die private Altersvorsorge hat massiv gelitten.
Die Lehre ist klar: Eine Altersvorsorge, die Sicherheit verspricht, aber Kosten und Intransparenz verschweigt, ist keine Lösung. Verbraucher benötigen faire Produkte, die Renditechancen eröffnen und zugleich rechtlich verlässlich sind.
Ob die Frühstartrente ein Schritt in diese Richtung ist oder nur ein weiteres Experiment, das in einigen Jahren scheitern wird, bleibt offen. Klar ist jedoch: Ohne tiefgreifende Reformen droht die Altersvorsorge in Deutschland dauerhaft in der Krise zu bleiben.
Für Verbraucher bedeutet das: Informiert bleiben, kritisch hinterfragen und im Zweifel juristische Hilfe suchen. Für Politik und Versicherungswirtschaft gilt: Nur wer die Fehler der Vergangenheit anerkennt, kann die Zukunft der Altersvorsorge retten.
Autor:
Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com