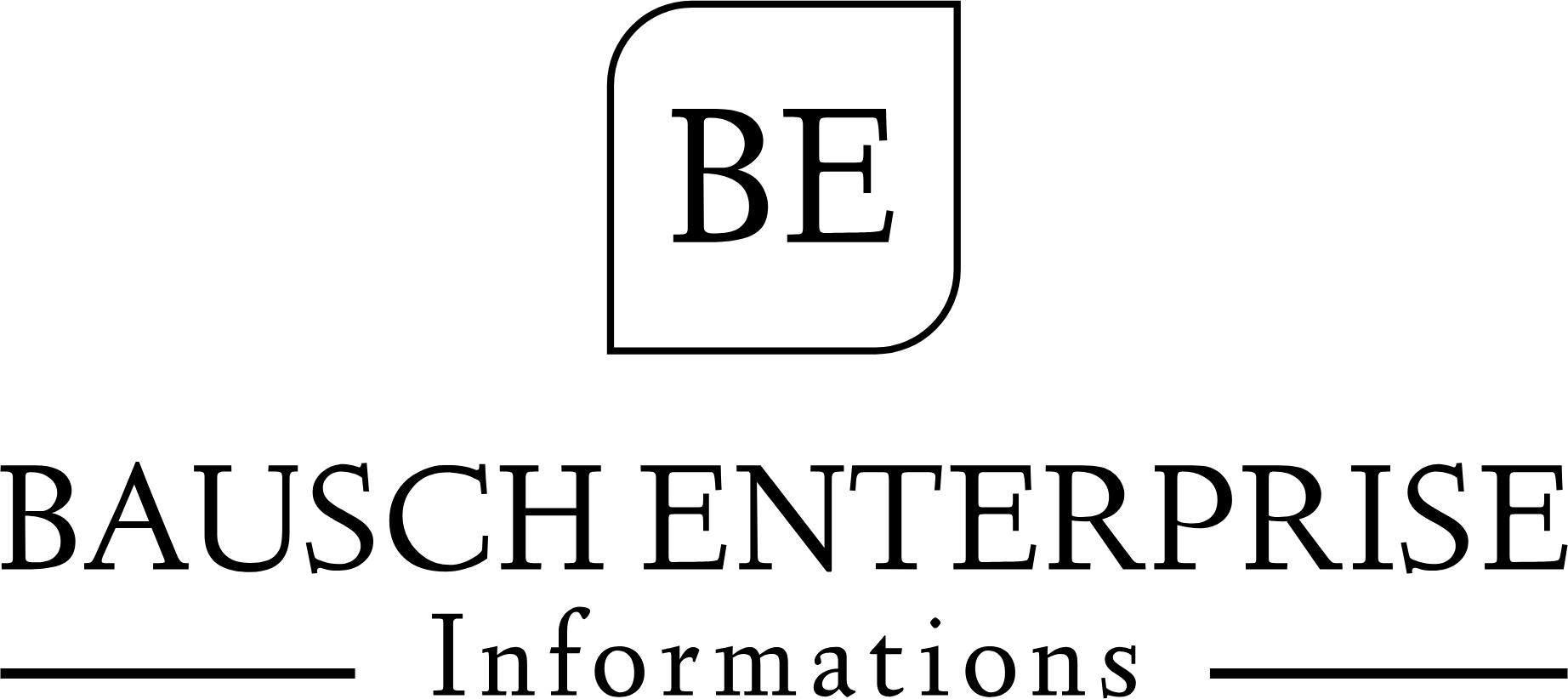Warum schließen wir Jahr für Jahr Millionen neuer Policen ab – und warum fühlt sich das Ergebnis für so viele am Ende kleiner an als das Versprechen?
Ein Markt, der wächst – und Zweifel, die lauter werden
Die Lebensversicherung gilt seit Jahrzehnten als stilles Versprechen: kollektiv Risiken abfedern, individuell Sicherheit schaffen. Doch der Blick in die neuesten Branchendaten zeigt ein anderes, widersprüchliches Bild. Ende 2024 zählten deutsche Anbieter 80,3 Millionen laufende Hauptversicherungen – eine schiere Masse an Verträgen, die verdeutlicht, wie tief das Produkt in der Alters- und Hinterbliebenenabsicherung verankert ist. Zugleich kamen allein 2024 über 4,29 Millionen neue Policen hinzu; die Abschlussdynamik ist also ungebrochen – und das, obwohl die öffentliche Debatte über Rendite, Kosten und Transparenz an Schärfe gewinnt.
Der Markt trägt Milliarden: 91,8 Mrd. Euro gebuchte Bruttobeiträge 2024, 99,1 Mrd. Euro ausgezahlte Leistungen – Größenordnungen, die eindrucksvoll klingen, aber wenig über das Nettoempfinden der Versicherten verraten. Denn das Gefühl, „es kommt zu wenig raus“, lässt sich nicht mit einer einzigen Zahl einfangen; es entsteht im Zusammentreffen von Kosten, Zinsumfeld, Produktdesign – und Erwartungen, die aus den Hochzinsjahren stammen, in denen Lebensversicherungen noch 7,5 Prozent Nettoverzinsung schafften (Jahr 2000). 2024 lag der Wert bei 2,37 Prozent.
„Das Versprechen ist ausgedünnt“ – kritische Stimmen aus dem Inneren
Sven Enger kennt die Branche von innen – als ehemaliger Vorstand großer Lebensversicherer – und er begleitet heute Verbraucher. Sein Urteil ist hart: „Das System lebt von Beiträgen, nicht vom Ergebnis beim Kunden. Das ursprüngliche Solidarversprechen ist ausgedünnt.“ Prof. Philipp Schade, Aktuar und Gutachter, spricht von einem „aktuariellen Ungleichgewicht“: In seinen Rückabwicklungsanalysen sieht er wiederkehrende Muster, in denen die Differenz zwischen theoretisch möglicher Marktrendite und tatsächlichem Vertragsoutput über Jahrzehnte stetig klafft – nicht als Ausreißer, sondern strukturell. Beiden geht es nicht um Polemik, sondern um die nüchterne Frage: Wie nah liegt das heutige Produkt noch an seinem Gründungsmythos – und wie weit am Geschäftsinteresse?
Zahlen mit Zwischentönen – was die GDV-Statistik wirklich sagt
Die Statistik liefert keine Empörung, sondern Messwerte – und die erzählen eine komplexe Geschichte. Erstens: Die Lebensversicherung ist ein zentraler Zahlungsstrom der Gesellschaft. Die Leistungen der Branche (ohne Rückkäufe) entsprechen rund 23 Prozent der jährlichen Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung; rechnet man alle Auszahlungen ein, sind es 28,7 Prozent. Das ist relevanter sozialer Transfer – privat organisiert.
Zweitens: Die Produktlandschaft verschiebt sich. „Klassisch“ mit Garantiezins verliert an Gewicht, fondsgebundene und hybride Formen mit Garantien legen zu – ein Versuch, Renditechancen und Sicherheiten neu zu mischen. Drittens: Die Leistungsverpflichtungen der Unternehmen steigen weiter, 2024 um 27,1 Mrd. Euro – ein Spiegel dafür, dass künftige Zusagen real finanziert werden müssen und keine reine Buchübung sind. Viertens: Hinter dem System steht ein gewaltiger Kapitalstock – 1.019 Mrd. Euro Bilanzwert der Kapitalanlagen (ohne Pensionskassen und -fonds), ergänzt um 215,9 Mrd. Euro für Rechnung der Policeninhaber bei fondsgebundenen und hybriden Produkten.
All das ist solide – und doch bleibt die Frage offen, warum sich so viele Verbraucher am Ende kleiner fühlen, als die Summen groß sind. Genau hier setzen Enger und Schade an.

Rendite vs. Realität – wenn die Nullerjahre in den Köpfen weiterleben
Die kognitive Dissonanz ist programmiert: Wer mit den Erinnerungen an die 1990er und frühen 2000er abschließt, erwartet „Zins und Zinseszins“ – nur ist die Nettoeinnahme der Branche aus Kapitalanlagen heute nicht mehr die von gestern. Die Nettoverzinsung fiel von 7,5 Prozent (2000) über Jahre bis auf 2,16 Prozent (2022) und steht 2024 bei 2,37 Prozent – eine Stabilisierung auf niedrigerem Niveau, nicht die Rückkehr der alten Welt.
Das ist keine „Schuld“ der Versicherer, sondern ein Umfeldbefund. Aber: Produktkosten, Vertrieb, interne Garantiekosten und Sicherheitsmechanismen werden aus eben dieser laufenden Ertragsdecke bezahlt. Was übrig bleibt, kann nicht gleichzeitig konservativ sicher, kostspielig, in der Verwaltung, stark reguliert, hochprovisioniert – und dennoch renditestark sein. „Wenn die Decke kürzer wird, spürt es als Erster der Kunde an der Ablaufleistung“, kommentiert Enger. Schade ergänzt: „Aus aktuarieller Sicht ist Ehrlichkeit über die Ertragsdecke der erste Schritt – und die konsequente Reduktion nichtwertschöpfender Kosten der zweite.“
Was das Produkt heute leistet – und was es nicht mehr leisten kann
Die Branche kann vieles, was kein ETF-Sparplan leisten will: kollektive Langlebigkeitsabsicherung, biometrische Risiken abdecken, lebenslange Renten zahlen. Das kostet – und darf kosten. Doch es belastet die Nettoerträge in einer Welt, in der Zinsen, Marktzyklen und Regulatorik den Spielraum enger ziehen. Die GDV-Zahlen zeigen die Konsequenz: Die Kapitalanlagen sind breit gestreut, aber stark von festverzinslichen Papieren geprägt; Umschichtungen in renditestärkere Segmente geschehen vorsichtig, weil Solvenz, Garantien und Aufsicht Grenzen setzen.
Die Gretchenfrage lautet daher nicht „Lebensversicherung – ja oder nein?“, sondern: „Für wen, mit welchem Ziel, zu welchen Kosten und mit welcher Offenheit?“ Wer Langlebigkeitsrisiko kollektiv absichern will, bekommt dafür etwas, das ein Depot nicht bietet – aber muss akzeptieren, dass der Preis real ist. Wer Vermögensaufbau priorisiert, benötigt Kostentransparenz und Renditenähe. Genau an diesem Schnittpunkt kritisieren Enger und Schade, dass Verträge zu oft wie „Alleskönner“ verkauft werden, die implizite Kompromisse verschleiern.
Verträge, Vertrieb, Vertrauen – die Dreifachprobe
Die Stornoquote ist mit 2,72 Prozent (2024) im historischen Maßstab nicht hoch – ein Zeichen dafür, dass viele Kunden dabei bleiben. Doch Storno ist ein grobes Signal. Feiner wird das Bild, wenn man Beratungsprotokolle, Kostensätze und die tatsächliche Zielerreichung prüft. Enger kritisiert, dass der Vertrieb ökonomisch primär für Abschlüsse belohnt wird: „Die Anreizsysteme honorieren Neuverträge, nicht Kundenerfolg.“ Schade hält dagegen, was mathematisch zu halten ist: eine ehrliche Effektivkostenkommunikation und Ergebnisprognosen, die Szenarien zeigen – einschließlich der nüchternen Variante, dass kostengünstige Kapitalmarktvehikel in vielen Fällen die Vermögensseite schlagbar gestalten, wenn keine biometrischen Risiken abgesichert werden müssen.
Die Branche verweist zu Recht auf ihre volkswirtschaftliche Rolle – ohne private Kapitaldeckung wäre das Alterssicherungssystem angreifbarer. 2024 stiegen die Leistungsverpflichtungen um 27,1 Mrd. Euro, die Auszahlungen lagen bei 99,1 Mrd. Euro; das ist Systemleistung, kein PR-Sprech. Aber Systemleistung rechtfertigt nicht jedes Produktdesign und jede Kostenstruktur. Vertrauen entsteht dort, wo Produkte verständlich sind, Erwartungen sauber kalibriert werden – und die Wertschöpfungskette konsequent auf das Kundenergebnis ausgerichtet ist.

„Neu denken“ heißt nicht „abschaffen“ – sondern ehrlich priorisieren
Was wäre eine zeitgemäße Lebensversicherung? Enger fordert drei kulturelle Verschiebungen: vom Abschluss zum Ergebnis, von der Intransparenz zu klaren Effektivkosten, von pauschalen Heilsversprechen zu präzisen Eignungsaussagen. Schade ergänzt die technische Seite: glasklare Offenlegung der Kalkulationslogik, robuste, prüffähige Prognosemodelle, und eine Kosten- und Risikosteuerung, die die reale Nettonutzenkurve des Kunden optimiert – nicht die Vertriebskennzahl.
Die GDV-Daten liefern die Folie: Der Sektor ist groß, stabil, reguliert – und er steht unter einem Innovationsdruck, der nicht nur digital ist. Hybride und fondsgebundene Produkte wachsen, weil sie Renditechancen zurückholen sollen; gleichzeitig müssen Garantien in einer Solvency-II-Welt verantwortbar bleiben. Das ist machbar – wenn die Kommunikation die Kompromisse offenlegt und die Kosten den Kundennutzen nicht erdrücken.
Gesellschaftliche Einordnung – warum die Frage größer ist als der einzelne Vertrag
Die Lebensversicherung ist keine Randbranche. Sie kanalisiert langfristiges Sparen, finanziert Staats- und Unternehmensschulden mit und wirkt als Puffer in Krisen. Der Kapitalstock jenseits der fondsgebundenen Sphären liegt bei 1.019 Mrd. Euro – ein Betrag, der erklärt, warum die Debatte immer auch eine über Kapitalmarktstabilität ist. Aber Stabilität ohne Fairness verliert Legitimität. Wenn Millionen Menschen das Gefühl haben, dass ihr Anteil am Ertrag zu klein ist, entsteht Rissbildung – erst im Vertrauen, dann im Verhalten. Die Folge wären weniger private Vorsorge, mehr Belastung öffentlicher Systeme – und genau das will niemand.
Darum ist „neu denken“ kein Angriff, sondern eine Einladung. Die Branche verfügt über Risikokompetenz, Aufsichtsroutinen und Kapitalzugang – sie kann den Wandel tragen. Enger sieht die Chance in einer Ergebnis-Kultur, die getestet und gemessen wird. Schade in einer aktuariellen Klarheit, die die Mathematik dahin zurückführt, wofür sie da ist: nicht Produkte zu rechtfertigen, sondern Nutzen zu quantifizieren.
Schlussfrage – und ein Maßstab
Die Lebensversicherung muss heute etwas leisten, was schwerer ist als in den Zins-Hochzeiten: Sie muss erklären, warum sie – trotz niedriger Nettoverzinsung – für bestimmte Ziele unverzichtbar ist, und sie muss beweisen, dass jeder Euro Kosten begründet ist. Die Daten helfen beim Erdungstest, nicht bei der Ausrede. Über 4,29 Mio. neue Verträge pro Jahr zeigen Vertrauen – oder Trägheit. 99,1 Mrd. Euro Leistungen zeigen Wirkung – aber nicht, wie gerecht sie verteilt sind. 2,37 Prozent Nettoverzinsung zeigt Realismus – und zwingen zur Effizienz.
Vielleicht ist der simpelste Maßstab der härteste: Würde man diesen Vertrag auch seinem eigenen Kind empfehlen – mit ehrlicher Darstellung der Alternativen, der Kosten und der Risiken? Wenn die Antwort „ja“ lautet, gewinnt die Lebensversicherung ihre Zukunft zurück. Wenn nicht, dann ist es Zeit, nicht den Kunden zu erziehen, sondern das Produkt zu verändern.
V.i.S.d.P
Dr. Rainer Schreiber
Dozent, Erwachsenenbildung & Personalberater
Über den Autor:
Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber, mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Der Blog schreiber-bildung.de bietet Themen rund um Bildung, Weiterbildung und Karrierechancen. Sein Interesse liegt in der beruflichen Erwachsenenbildung und er publiziert zum Thema Personalberatung, demografischer Wandel und Wirtschaftspolitik.
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com