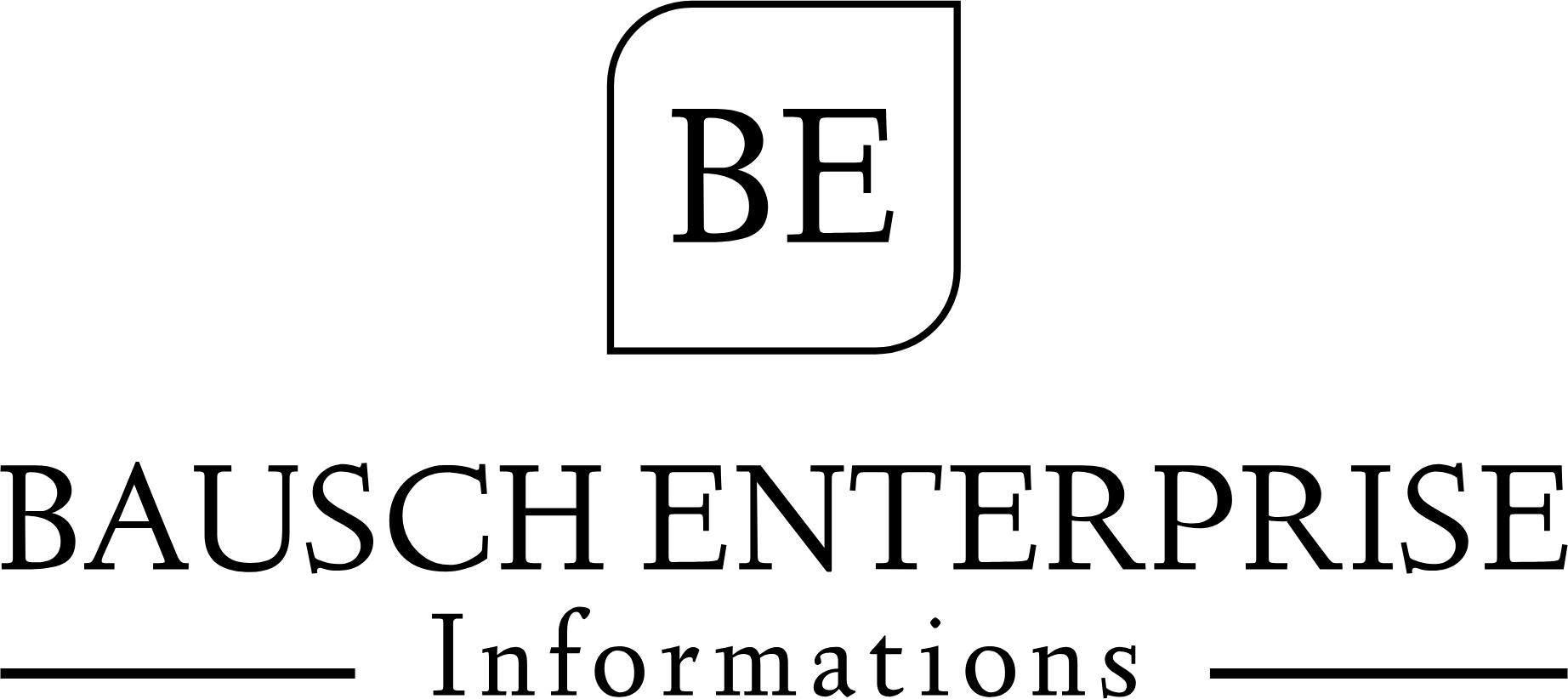Die Babyboomer gehen in Rente, die Zinsen drehen, die Demografie kippt – schafft die Branche den Vertrauenssprung?
Wenn eine Generation gleichzeitig „Kasse macht“
Ausgerechnet jetzt gerät die deutsche Versicherungswirtschaft unter Druck: Die Babyboomer – die geburtenstarken Jahrgänge 1957 bis 1969 – treten reihenweise in den Ruhestand ein. Laut Statistischem Bundesamt werden bis 2036 rund 12,9 Millionen Erwerbstätige die gesetzliche Altersgrenze überschreiten. Das ist nicht nur eine arbeitsmarktpolitische Wucht, sondern trifft auch Lebens- und Rentenversicherer in einer heiklen Phase: Zugleich steigen Leistungsfälle (Renten- und Kapitalzahlungen), die Kundschaft fordert Liquidität, und die Öffentlichkeit achtet sensibler denn je auf Kosten, Transparenz und Nettoerträge.
Der demografische Trend ist eindeutig: Die Zahl der Menschen ab 67 Jahren wird bis Mitte der 2030er Jahre deutlich zunehmen; Destatis beziffert den Zuwachs gegenüber heute mit mehreren Millionen. Die Alterung der Bevölkerung verschiebt den Druck im System – weg von Beitragssammlern, hin zu Leistungsempfängern.
Die doppelte Zange: Demografie und Ertrag
2024 meldete der GDV für Lebensversicherer einen Kapitalanlagenbestand von rund 1.019 Mrd. €; die Nettoverzinsung lag bei 2,37 Prozent (nach 2,27 Prozent im Vorjahr). Das ist ein zarter Rückenwind nach der Zinswende – aber real, also inflationsbereinigt, bleibt für viele Kunden wenig übrig. Genau hier stößt die Branche auf das Vertrauensthema: Wenn jahrzehntelang eingezahltes Geld in der Kaufkraft zurückfällt, bröckelt der Nimbus der „sicheren“ Lebensversicherung.
Gleichzeitig rollt eine Auszahlungswelle heran: Millionen Verträge erreichen die Leistungsphase, während die Politik parallel über die Tragfähigkeit des Sozialstaats und ein höheres Regelalter streitet – ein Debattenrahmen, den internationale Beobachter (IMF, Medien) mit Verweis auf die alternde Gesellschaft als Wachstums- und Finanzierungstest für Deutschland einordnen.
Prof. Dr. Philipp Schade fasst die Lage trocken zusammen: „Demografie ist kein kurzfristiger Schock, sondern eine Gleichung. Wenn mehr Verträge auszahlen und die reale Rendite dünn bleibt, entscheidet Mathematik – nicht Marketing – über Vertrauen.“

„Wenn alle gleichzeitig zur Kasse gehen“ – Liquidität trifft Bilanz
Was bedeutet das konkret? Babyboomer sind nicht nur viele, sie haben auch überproportional lange Beitragsbiografien. Für die Bilanz heißt das: Höhere Auszahlströme treffen auf Portfolios, die unter Solvency II naturgemäß stark in festverzinslichen Papieren engagiert sind. Diese liefern nun zwar höhere laufende Kupons als noch 2021/22, doch der Bewertungsruck aus 2022 (stille Lasten bei Anleihen) wirkt in manchen Beständen nach – und wird erst sukzessive „ausgerollt“, wenn die Papiere fällig werden oder neu investiert wird. Der Höchstrechnungszins wurde vom BMF für Neuverträge auf 1,0 Prozent angehoben – eine späte, aber sinnvolle Anpassung. Für Altbestände mit niedrigen Garantien ändert das kurzfristig nichts, mittelfristig verbessert es die Produktkalkulation neuer Tarife.
Sven Enger ordnet ein: „Die Zinswende lindert Symptome, nicht die Grunderkrankung. Wer Sicherheit verspricht, darf Rendite nicht romantisieren. Entscheidend ist, ob Produkte künftig nach Kosten real positiv werden – erst dann gewinnt die Branche die Boomer zurück.“
Vertrauensprüfung live: Riester als Menetekel
Wie sensibel der Markt reagiert, zeigt die Riester-Rente: Rund 5 Mio. Kündigungen seit Start, ca. 220.000 allein Januar–August 2025 – auf Rekordkurs. Viele Verträge werden zudem nicht mehr aktiv bespart. Für die Versicherer ist das ein Stimmungsbarometer: Wenn die prominenteste staatlich geförderte Säule in die Kündigungslawine läuft, urteilen Verbraucher faktisch über Kosten-/Rendite-Verhältnis und Produktlogik.
Prof. Philipp Schade: „Die Mathematik lügt nicht. Wenn laufende Kosten nahe an der Nettoverzinsung liegen, bleibt nach Inflation wenig oder nichts. Das ist für eine Generation, die jetzt Liquidität braucht, keine tragfähige Geschichte.“
Arbeitsmarkt, Pflege, Wohnen: Der Kontext verschärft das Risiko
Die Babyboomer prägen nicht nur die Versicherungsseite, sie verändern auch die Makrolage: Fachkräftemangel, steigende Sozial- und Gesundheitsausgaben, Druck auf kommunale Infrastruktur. Studien und Regierungsäußerungen warnen vor einem älter werdenden, langsamer wachsenden Deutschland, in dem die Arbeitskräftezahl sinkt und Sozialausgaben steigen – mit Rückwirkungen auf Zins, Wachstum und Risikoappetit. Das verschärft den Auftrag an Versicherer: klare Produkte, saubere Kosten, robuste Renditemodelle.
Sven Enger spitzt zu: „Die Branche darf nicht hoffen, dass Demografie und Zins von allein die Story retten. Jetzt zählt Handwerk: Produktbereinigung, Kostendisziplin, Datentransparenz. Sonst verlieren wir die Boomer an Auszahlungen – und die Jungen an ETFs.“
Juristisch aufsichtlich: Wo die Latte künftig liegt
Für die Lebensversicherer ist das kein reines Vertriebsproblem, sondern ein aufsichts- und haftungsrechtliches Thema. Wenn die Boomer-Generation massenhaft in die Leistungsphase wechselt, werden Beratungsdokumentation, Geeignetheit, Transparenz der Kosten und der Umgang mit Bestandsübertragungen (Portfoliotransfers) zum Risikofilter. Die BaFin erwartet seit Jahren stabile Geschäftsorganisationen, sauberes Risikomanagement und adressiert Missstände zunehmend öffentlich – von Governance bis Vertrieb. (Kontext: MaGo/MaRisk-Denke, ESG-Risiken, Datenqualität.)
Juristisch stellt sich die Kernfrage: Wurden Kundinnen und Kunden bei Vertragsabschluss realistisch über Rendite-/Kosten-Spannung aufgeklärt? Wo Falschberatung oder mangelhafte Widerrufsbelehrungen vorliegen, ergeben sich Rückabwicklungs- und Schadensersatzpfade – eine Welle, die im Boomerruhestand neue Relevanz bekommt.
Prof. Schade: „Die Babyboomer bringen zwei Dinge mit: hohe Volumina – und Rechtsschutzversicherungen. Wer schlampig beraten hat, wird das jetzt in den Beständen sehen.“
Produktarchitektur: Was jetzt trägt (und was nicht)
Die gute Nachricht vorweg: Die Zinswende erlaubt erstmals seit Jahren wieder Garantien oberhalb der Nullmarke. Für die Kalkulation neuer Tarife bedeutet das mehr Spielraum, mehr Luft zum Atmen. Doch die schlechte Nachricht folgt auf dem Fuße: Jede Garantie frisst Rendite – und genau das ist das Dilemma. Denn die Generation der Babyboomer, die nun massenhaft in die Leistungsphase eintritt, braucht beides zugleich: die Sicherheit, dass ihre Altersvorsorge nicht wegbrechen kann, und den realen Ertrag, der über die Inflationsrate hinausgeht. Ein Balanceakt, den die Branche lange zu vermeiden versuchte, doch jetzt nicht mehr umgehen kann.
Konkret bedeutet dies eine Neuausrichtung der Produktarchitektur. Das Kostenniveau muss runter, deutlich unter die Marke von 0,5 Prozent pro Jahr. Der Kapitalmarkt verkraftet das, moderne IT-Strukturen und digitale Prozesse machen es technisch möglich – aber der Wille in den Chefetagen muss folgen. Gleichzeitig muss die Einfachheit rauf: Produkte, die ohne Aktuarstudium verstanden werden können, sind keine naive Wunschvorstellung, sondern Voraussetzung für Vertrauen. Hybride Modelle könnten eine Brücke schlagen, allerdings nur, wenn sie mit Ehrlichkeit konstruiert sind. Wer eine Garantie möchte, soll sie bekommen – aber mit der klaren Transparenz, dass sie Rendite kostet. Wer hingegen höhere Renditechancen sucht, darf nicht mit Prospektlyrik abgespeist werden, sondern benötigt kostengünstige und regelgebundene Kapitalmarktstreuung, etwa über breit aufgestellte Index- oder ETF-Bausteine.
Sven Enger bringt es auf den Punkt: „Wir benötigen Mehrwert, der auch nach Abzug aller Kosten noch sichtbar ist. Die Boomer akzeptieren keine Black-Box mehr.“ Seine Einschätzung verweist auf einen mentalen Wendepunkt: Eine ganze Generation, die über Jahrzehnte zur Geduld erzogen wurde, erwartet nun endlich Taten. Der Markt steht damit nicht nur ökonomisch, sondern auch reputativ vor einer Bewährungsprobe. Wer jetzt nicht liefert, riskiert nicht nur Verträge – sondern das Fundament des Vertrauens in die Altersvorsorge.
Liquidität und Kommunikation: Die operative Nagelprobe
In den nächsten Jahren wird der Alltag zeigen, wer liefern kann: Auszahlungsprozesse müssen reibungslos laufen, Rückkaufswerte nachvollziehbar sein, Steuerfragen proaktiv geklärt. Hier entscheiden sich Reputation und Weiterempfehlung – besonders in einem Markt, in dem die Neugewinnung teurer wird und Stornoprävention strategisch ist.
Die demografische Welle wird außerdem Portfolioumbauten beschleunigen: Manche Häuser werden Bestände abgeben, andere selektiv zukaufen. Wer das macht, sollte an Kundenkommunikation nicht sparen – sonst wird „juristisch korrekt“ schnell „kommunikativ desaströs“, wie es Praktiker nennen.

Der Blick über die Bilanz: gesellschaftliche Verantwortung
Die Diskussion um die Zukunft der Altersvorsorge nimmt längst nicht mehr nur Fachkreise in Anspruch, sondern wird zunehmend zum politischen Zankapfel. Mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand steigen nicht nur die individuellen Leistungsansprüche, sondern auch die fiskalischen Belastungen: öffentliche Zuschüsse an die gesetzliche Rente erreichen Rekordhöhen, während gleichzeitig Erwartungen und Forderungen an private Versicherer wachsen. Politik und Gesellschaft blicken auf die Branche mit der impliziten Bitte – oder besser: dem Druck – Stabilität um jeden Preis zu gewährleisten. Medienberichte warnen bereits vor einer tickenden Zeitbombe, die langfristig nicht nur die öffentlichen Haushalte, sondern auch die Finanzierbarkeit privater Modelle unterminieren könnte. Versicherungsunternehmen mahnen deshalb Strukturreformen an, die über kosmetische Änderungen hinausgehen und das System grundlegend neu ordnen.
Für die Branche bedeutet dies einen Paradigmenwechsel: Nicht mehr allein die Größe des verwalteten Kapitalbestands oder die Imagekampagnen entscheiden über Vertrauen, sondern die nachweisliche Fähigkeit, Verbraucherschutz ernst zu nehmen, Kosten klar und transparent offenzulegen und nachhaltige Renditeprozesse zu etablieren. Nur wer diese Elemente nicht verspricht, sondern in überprüfbaren Strukturen verankert, sichert sich die ökonomische Tragfähigkeit – und die reputative „Lizenz zum Operieren“ in einem Markt, der sich gerade neu sortiert.
Prof. Dr. Philipp Schade bringt diesen Anspruch präzise auf den Punkt: „Altersvorsorge ist kein Marketingthema. Sie ist eine gesellschaftliche Rechenaufgabe – und die Lösung muss im Netto stimmen.“ Hinter dieser Aussage steckt mehr als eine spitze Bemerkung. Sie ist ein programmatischer Fingerzeig darauf, dass es in Zukunft nicht um schöne Hochglanzbroschüren oder symbolische Maßnahmen wie die Frühstartrente gehen kann, sondern um konkrete Ergebnisse, die sich im Portemonnaie der Versicherten messen lassen. Die Herausforderung lautet: Wie schafft man es, Produkte zu entwickeln, die nicht nur formell sicher sind, sondern auch in Zeiten steigender Lebenserwartung, hoher Inflation und wachsender Unsicherheit tatsächlich Wert generieren? Genau an dieser Schnittstelle entscheidet sich, ob die Altersvorsorge der Zukunft noch Vertrauen verdient.
Was die Zahlen uns jetzt schon sagen
Die Babyboomer strömen in den Ruhestand, und mit ihrem schubweisen Austritt aus dem Arbeitsmarkt prallen die Leistungsfälle und Liquiditätsanforderungen wie eine Welle auf die Versicherungswirtschaft. Gleichzeitig bleibt die Realrendite unter Druck: Zwar stieg die Nettoverzinsung 2024 auf 2,37 Prozent, doch angesichts einer Inflation von 2 bis 3 Prozent bleibt die Kaufkraft der Verbraucher brüchig – ein fragiles Fundament für eine Altersvorsorge, die Sicherheit verspricht. Noch gravierender wirkt das Signal der Kunden selbst: Riester-Kündigungen erreichen 2025 Rekordhöhen, ein Weckruf, der zeigt, dass das Vertrauen längst Risse bekommen hat. Der Zinsrahmen mag sich durch die Anhebung des Höchstrechnungszinses auf 1,0 Prozent ab 2025 verbessert haben, doch diese kleine Erleichterung gilt nur für neue Abschlüsse – die Altbestände bleiben von den jahrzehntelangen Niedrigzinsen gezeichnet. Sven Enger bringt es auf den Punkt: Diese Gemengelage zwingt die Branche dazu, Vermögensaufbau konsequent nach Kosten zu denken. Alles andere gleicht einer Wette auf die Geduld der Kunden – und genau diese Geduld ist nach Jahren enttäuschter Erwartungen und intransparenter Produkte nahezu aufgebraucht. Die entscheidende Frage lautet also: Reicht die Anpassung an technische Rahmenbedingungen, oder braucht es eine strukturelle Kehrtwende, um das Vertrauen zurückzugewinnen?
Juristisch fragend: Reicht das Aufsichts-Toolkit?
Aufsichtliche Instrumente (Solvency II, Governance-Rundschreiben, Produktaufsicht) sind vorhanden. Doch die Boomer-Gleichzeitigkeit testet sie neu: Sind die Kundennutzen-Nachweise streng genug? Sind Kostenobergrenzen und Vergütungsregeln ausreichend klar, um Fehlanreize im Vertrieb zu kappen? Wird Datenqualität (Storno, Rückkaufswerte, Beschwerden) so erhoben, dass Frühwarnsignale rechtzeitig sichtbar werden?
Schade plädiert für „pragmatische Strenge“: „Nicht neue Paragrafen, sondern harte, vergleichbare Kennzahlen: Net Return nach Kosten, Transparenzgrade, Reaktionszeiten. Wenn man Mängel messen kann, kann man sie auch managen.“
Ausblick: Der Vertrauenssprung
Die Krise kommt nicht „zur Unzeit“ – sie kommt in einem Moment, der wie ein Lackmustest wirkt. Denn die Babyboomer zwingen die Versicherungswirtschaft genau jetzt, das zu liefern, wofür sie seit Jahrzehnten wirbt: verlässliche Leistung, spürbare Sicherheit, nachvollziehbare Rendite. Die Zinswende hat zwar neuen technischen Spielraum eröffnet, doch zugleich wirken Demografie und Öffentlichkeit als doppelter Druckverstärker. Millionen Verbraucher erwarten endlich Klartext – nicht Hochglanzbroschüren, sondern belastbare Zahlen und Ergebnisse. Was bedeutet das für die Branche? Sie muss beweisen, dass Produkte mehr sind als Versprechen, dass Kostendisziplin nicht als Fußnote im Geschäftsbericht, sondern als Vorstandsthema verankert wird. Sie muss zeigen, dass Kommunikation in der Leistungsphase nicht von juristischen Klauseln dominiert wird, sondern von verständlicher Transparenz. Und sie muss Regeltreue nicht nur erfüllen, sondern auch sichtbar belegen – gegenüber Kunden, Aufsicht und Öffentlichkeit. Die eigentliche Frage lautet: Ist die Versicherungswirtschaft bereit, den Schritt vom Schutzbehauptungsmodus in den Beweismodus zu gehen? Genau daran wird sich entscheiden, ob das Vertrauen der Verbraucher in dieser historischen Phase zurückgewonnen werden kann – oder ob die Krise zum endgültigen Wendepunkt wird.
Fazit: Die Chance der Gleichzeitigkeit
Die Versicherungswirtschaft steht am kritischen Knotenpunkt: Demografische Wucht, Zinsregimewechsel und ein aufgeklärtes Publikum treffen zusammen. Wer jetzt Kosten senkt, Nettoerträge stärkt und Transparenz belegt, macht aus der Boomer-Welle keinen Stresstest, sondern einen Vertrauenssprung.
Für Verbraucher bedeutet das: genauer hinsehen, Netto-nach-Kosten prüfen, Beratungsdokumente sichern und – wenn nötig – juristische Wege nutzen. Für Versicherer heißt es: die eigene Erzählung mit Zahlen zu unterfüttern. Für die Aufsicht: die Kundensicht als harte Messgröße durchzusetzen.
Deutschland wird älter – und klüger. Wenn die Branche das ernst nimmt, kann sie ausgerechnet im schwierigsten Moment ihre größte Stärke beweisen: Planbarkeit im Unplanbaren.
Autor:
Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com