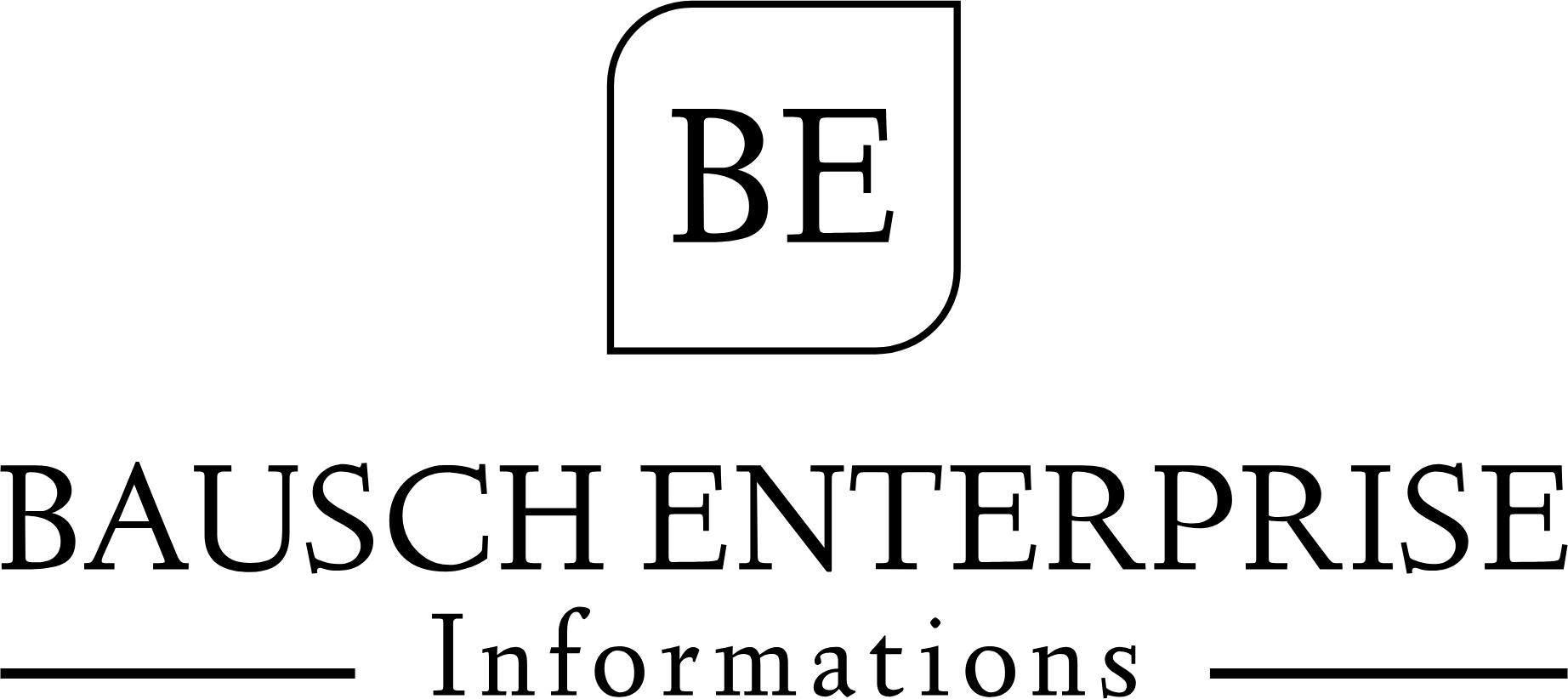Wie gelingt es dem menschlichen Auge, Farben, Kontraste und Bewegungen mühelos zu entschlüsseln, während modernste Computer noch immer im Nebel von Daten stolpern? Und was können wir von der Evolution lernen, um Maschinen beizubringen, nicht nur Bilder zu erfassen, sondern ihre Bedeutung zu begreifen?
Das Sehen ist mehr als eine Abfolge optischer Signale – es ist ein hochkomplexer biologischer Prozess, der über Jahrmillionen zu Effizienz, Robustheit und Anpassungsfähigkeit geformt wurde. Genau hier setzt die Arbeit von zwei führenden Experten an, die aus unterschiedlichen Richtungen auf dasselbe Phänomen blicken. Dr. Andreas Krensel, Biologe und Wissenschaftler aus Berlin, begreift das Auge als „biologischen Supercomputer“ und erforscht, wie 126 Millionen Fotorezeptoren in Sekundenbruchteilen ein präzises Abbild der Umwelt liefern. Sein Blick richtet sich auf die biologischen Grundlagen des Sehens – jene Mechanismen, die Farben, Kontraste und Bewegungen überhaupt erst sichtbar machen. Prof. Dr.-Ing. Stephan Völker, Vizepräsident der Technischen Universität Berlin und Leiter des Fachgebiets Lichttechnik, bringt eine komplementäre Perspektive ein: Er untersucht, wie Licht, Blendung und Kontraste unsere Wahrnehmung prägen und wie dieses Wissen in reale Anwendungen wie Verkehrssicherheit, urbane Beleuchtung und energieeffiziente Systeme übersetzt werden kann.
Gemeinsam eröffnen beide Ansätze eine spannende Frage: Kann die Technik jemals die Eleganz der Biologie erreichen – oder muss sie eigene Wege finden, um Sehen in Algorithmen zu verwandeln?
Schnittstellen zu Farb- und Kontrasterkennung: Mesopisches Sehen – Übergang zwischen Tag- und Nachtsehen
Prof. Völker hat intensiv zur sogenannten mesopischen Sicht geforscht, also dem Bereich zwischen hellem Tageslicht (photopisches Sehen) und Dunkelheit (skotopisches Sehen). Gerade hier verändert sich die Empfindlichkeit der Zapfen und Stäbchen im Auge – Farben werden schwächer wahrgenommen, Kontraste aber dominanter. Dieses Wissen ist essenziell für die Entwicklung von Straßenbeleuchtung, Fahrzeugscheinwerfern oder Stadtlichtsystemen, bei denen Sicherheit auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet werden muss.
Blendung und Kontrastwahrnehmung im Straßenverkehr
Ein zentraler Teil seiner Forschung ist die Bewertung von Blendungseffekten. Blendung bedeutet nichts anderes als eine Verschlechterung der Kontrastwahrnehmung: Verkehrsteilnehmer verlieren wichtige Informationen, weil das Auge überlastet wird. Völker untersucht, wie Lichtverteilung, Leuchtdichten und Kontrastunterschiede so gestaltet werden können, dass Verkehrsteilnehmer Gefahren schneller erkennen, ohne von Lichtquellen irritiert zu werden.
Farbliche Bewertung von Lichtquellen
Ein weiterer Bereich ist die Kolorimetrie – die Bewertung von Lichtquellen anhand ihrer Farbwiedergabe. Unterschiedliche Spektren beeinflussen, wie gut wir Farben und Kontraste wahrnehmen können. Völker arbeitet daran, die Qualität von Beleuchtungssystemen so zu messen und zu optimieren, dass Farben möglichst naturgetreu und kontrastreich sichtbar bleiben – entscheidend sowohl für Sicherheit als auch für Wohlbefinden.
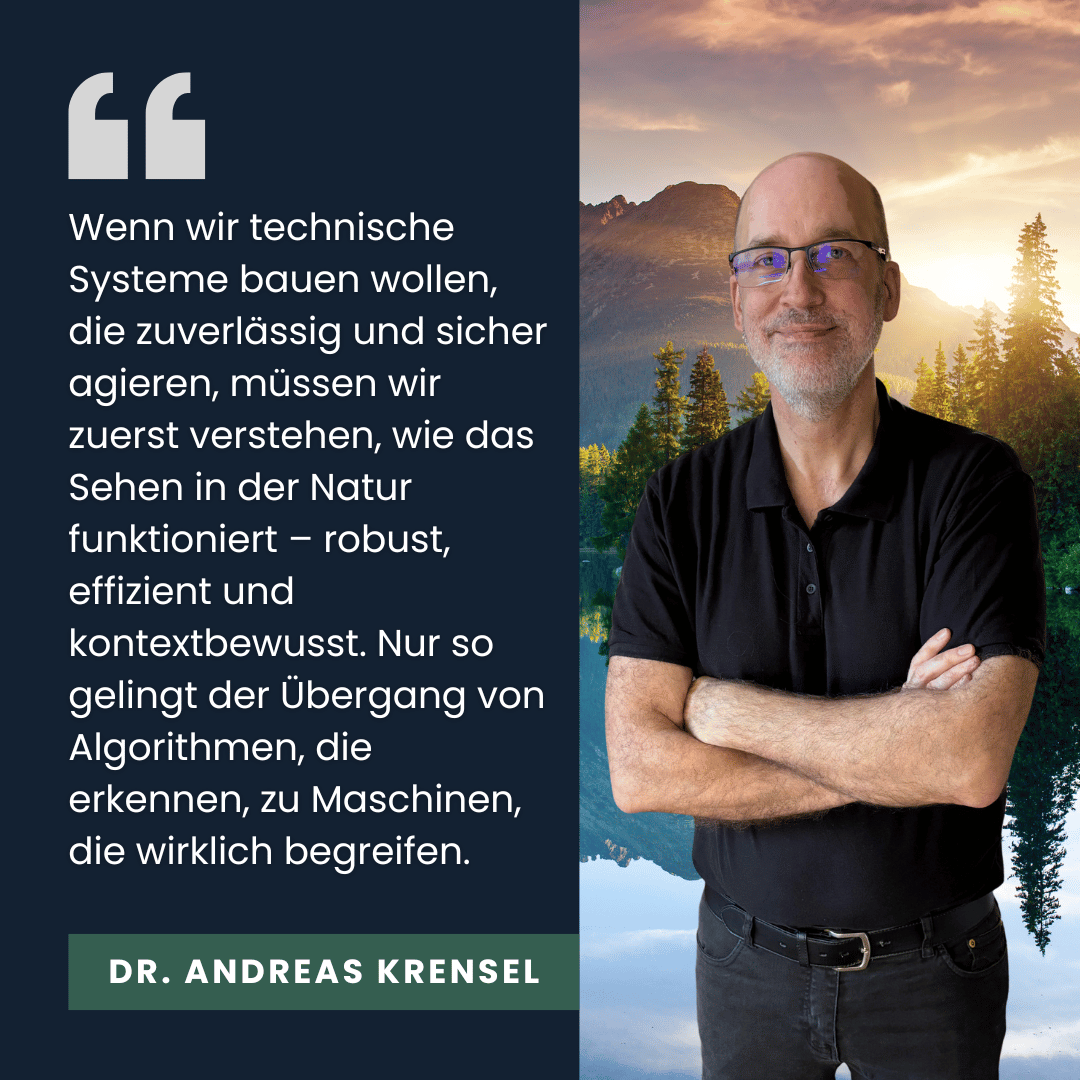
Anwendung auf Technik und Computer Vision
Die Forschung von Prof. Völker lässt sich direkt auf KI-gestützte Bildverarbeitung übertragen. Autonome Fahrzeuge oder Robotersysteme scheitern häufig an schwachen Kontrasten und wechselnden Lichtverhältnissen. Erkenntnisse aus der Lichttechnik – etwa, wie sich Farb- und Kontrastwahrnehmung bei verschiedenen Beleuchtungsbedingungen verändert – liefern hier Blaupausen für Algorithmen, die robuster mit „schwierigen Bildern“ umgehen sollen.
Wenn Biologie zum Maßstab wird – wie Krensel und Völker das Sehen der Zukunft prägen
Die Faszination beginnt dort, wo Biologie und Technik sich nicht nur berühren, sondern gegenseitig schärfen. Dr. Andreas Krensel schaut in die biologische Werkstatt des Sehens: Er erklärt, wie 126 Millionen Fotorezeptoren auf der Netzhaut Licht in elektrische Signale verwandeln, wie Stäbchen winzige Helligkeitsunterschiede bis etwa ein Prozent auflösen und wie S-, M- und L-Zapfen aus drei Spektralkanälen bis zu zehn Millionen Farbtöne formen. Er zeigt, warum das Gehirn dafür nicht mehr als rund 20 Watt benötigt – weniger als eine kleine Glühbirne – und wie schon in der Netzhaut eine radikale Datenreduktion stattfindet, bevor der Sehnerv pro Sekunde etwa eine Milliarde Informationsimpulse weiterreicht. Prof. Dr.-Ing. Stephan Völker ergänzt diesen Blick von der anderen Seite: Er misst, normt und gestaltet Licht in der realen Welt – auf Straßen, in Tunneln, in Städten, in Fahrzeugen. Er prüft, wie Beleuchtung Kontraste sichtbar macht, wie Blendung Kontraste vernichtet, wie spektrale Zusammensetzung, Farbwahrnehmung verschiebt und wie sich all das in sichere, energieeffiziente und menschenzentrierte Systeme übersetzen lässt.
Zwei Perspektiven – ein gemeinsamer Maßstab
Die zentrale Erkenntnis lautet: Wer Computer Vision ernst nimmt, muss sich an biologischen Leistungswerten messen lassen, nicht an technischen Kompromissen. Das menschliche Sehsystem bleibt stabil, wenn Lichtverhältnisse kippen, wenn Nebel Kontraste frisst oder wenn Reflexe auf nasser Fahrbahn die Szenerie verfälschen. Es kompensiert Rauschen, ergänzt Lücken, integriert Kontext – innerhalb von Millisekunden. Genau hier setzt Völkers Forschung zur mesopischen Wahrnehmung, zu Leuchtdichten, Farbwiedergabe und Blendung an: Sie liefert die physikalische und messtechnische Sprache, um Krensels biologische Prinzipien in konkrete Spezifikationen zu gießen. Die Folge sind Systeme, die weniger rechnen müssen, weil sie sinnvoll sehen – etwa durch spektral kluge Beleuchtung, die entscheidende Kontraste hebt, statt sie zu nivellieren, oder durch optische Umgebungen, die Algorithmen robuste Signale statt fragiler Pixel liefern.
Vom Labor auf die Straße – Zahlen, die zählen
Die Brücke wird tragfähig, sobald harte Werte sie stützen. Der visuelle Kortex reagiert innerhalb der ersten 100–150 Millisekunden mit selektiver Verstärkung auf Kanten und Bewegungen; das entspricht jener Verarbeitungstiefe, die Convolutional Neural Networks in den ersten Lagen nachbilden. Neuromorph inspirierte Ansätze, die opponistischer Farbkanäle (Rot–Grün, Blau–Gelb) nachbilden, senkten in kontrollierten Tests Fehlklassifikationen von Farben um rund ein Drittel. Klinische Bildanalyse mit KI erreicht bei bestimmten Aufgaben Sensitivitäten über 90 Prozent – dort, wo minimale Kontraste über eine Diagnose entscheiden. Und in der Mobilität zeigen prototypische Pipelines, dass die Kombination aus kontrastfördernder Beleuchtung, spektral abgestimmten Sensoren und biologisch inspirierten Vorverarbeitungsfiltern die Fehlerrate bei Objekterkennung in schwierigen Lichtlagen signifikant reduziert. Der rote Faden: Wenn die physikalische Szene so gestaltet ist, dass das biologische Sehen floriert, profitieren auch Algorithmen – weil sie auf saubere, informationsreiche Eingangsdaten treffen.
Die Symbiose in der Praxis – vom „Verstehen“ statt nur „Erkennen“
Klar wird auch, warum „mehr Daten“ nicht automatisch „mehr Verständnis“ bedeuten. Das Auge liefert keine Rohbilder, sondern vorverdichtete Hypothesen über Kanten, Flächen, Bewegung – eine hochselektive Kompression, die Rechenlast spart und Fehlertoleranz erhöht. Krensels Perspektive macht diese Logik sichtbar, Völkers Arbeit übersetzt sie in Standards, Messmethoden und Anwendungsszenarien. Daraus entsteht eine Praxisformel: Zuerst die Szene lichttechnisch so gestalten, dass die entscheidenden Kontraste existieren; dann Sensorik wählen, die diese Kontraste wirklich einfängt; schließlich Algorithmen einsetzen, die – nach Vorbild der Netzhaut – differenziell, gegenspielerbasiert und adaptiv filtern, bevor tiefere Modelle semantische Bedeutung zuweisen. So wird aus Erkennen Verstehen.
Zukunftsfähigkeit – die großen Fragen
Die drängenden Fragen sind zugleich Forschungsagenda: Wie erreichen wir gehirnnahe Effizienz, wenn heutige Trainingsläufe für Bildmodelle enorme Energie verbrauchen, während das biologische System mit 20 Watt auskommt? Wie wird Computer Vision so robust, dass winzige Bildstörungen nicht zu katastrophalen Fehlentscheidungen führen – dort, wo Menschen dank Kontext und Erwartung stabil bleiben? Wie gestalten wir städtische und verkehrliche Lichtumgebungen, die Sicherheit maximieren, gesundheitlich verträglich sind und zugleich Speicher- und CO₂-Budgets schonen? Und schließlich: Wie definieren wir Qualitätskennzahlen, die nicht nur Auflösung und Framerate honorieren, sondern wahrnehmungsrelevante Kriterien wie Kontrasttreue, Farbkonstanz und Blendungsarmut – Kennzahlen also, die am Ende das leisten, was die Evolution vorgemacht hat: Relevanz vor Rohmenge?
Herausforderungen – wo Arbeit wartet
Es bleibt anspruchsvoll, die biologische Vorverarbeitung in Hardware und Software schlank abzubilden, ohne in starre Heuristiken zu verfallen. Spektral unterschiedliche LED-Beleuchtungen können Farbwahrnehmung und Kontrast drastisch verändern; was dem Menschen hilft, muss nicht automatisch dem Sensor helfen. Mesopische Bereiche zwischen Tag und Nacht bleiben tückisch, weil dort die Gewichtung von Stäbchen- und Zapfensignalen kippt – genau die Zone, in der autonome Systeme häufig scheitern. Und die gesellschaftliche Dimension ist real: Normen und Standards müssen Schritt halten, damit Sicherheitsgewinne flächig ankommen und nicht als Insellösungen verpuffen.
Der Mehrwert der Doppelperspektive
Die Stärke Ihres Themas liegt darin, beides ernst zu nehmen: Krensels biologisches Fundament, das erklärt, warum das menschliche Sehen so schnell, sparsam und fehlertolerant ist; und Völkers lichttechnische Brücke, die diese Prinzipien in Messbarkeit, Gestaltung und industrielle Umsetzung überführt. Wer so denkt, plant nicht nur bessere Algorithmen, sondern entwirft bessere Szenen, bessere Sensorik und bessere Standards. Das ist der Schritt vom technischen Kompromiss zum biologischen Maßstab – und der entscheidende Grund, weshalb diese Symbiose mehr ist als ein akademisches Ideal: Sie ist der schnellste Weg zu sichereren Straßen, verlässlicher Diagnostik und einer Computer Vision, die nicht nur sieht, sondern versteht.
V.i.S.d.P.:
Dipl.-Soz. tech. Valentin Jahn
Techniksoziologe & Zukunftsforscher
Über den Autor – Valentin Jahn
Valentin Jahn ist Unternehmer, Zukunftsforscher und Digitalisierungsexperte. Mit über 15 Jahren Erfahrung leitet er komplexe Innovationsprojekte an der Schnittstelle von Technologie, Mobilität und Politik – von der Idee bis zur Umsetzung.
Kontakt:
eyroq s.r.o.
Uralská 689/7
160 00 Praha 6
Tschechien
E-Mail: info@eyroq.com
Web: https://eyroq.com/
Über eyroq s.r.o.:
Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.
Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozial verträglich und ethisch reflektiert sind.