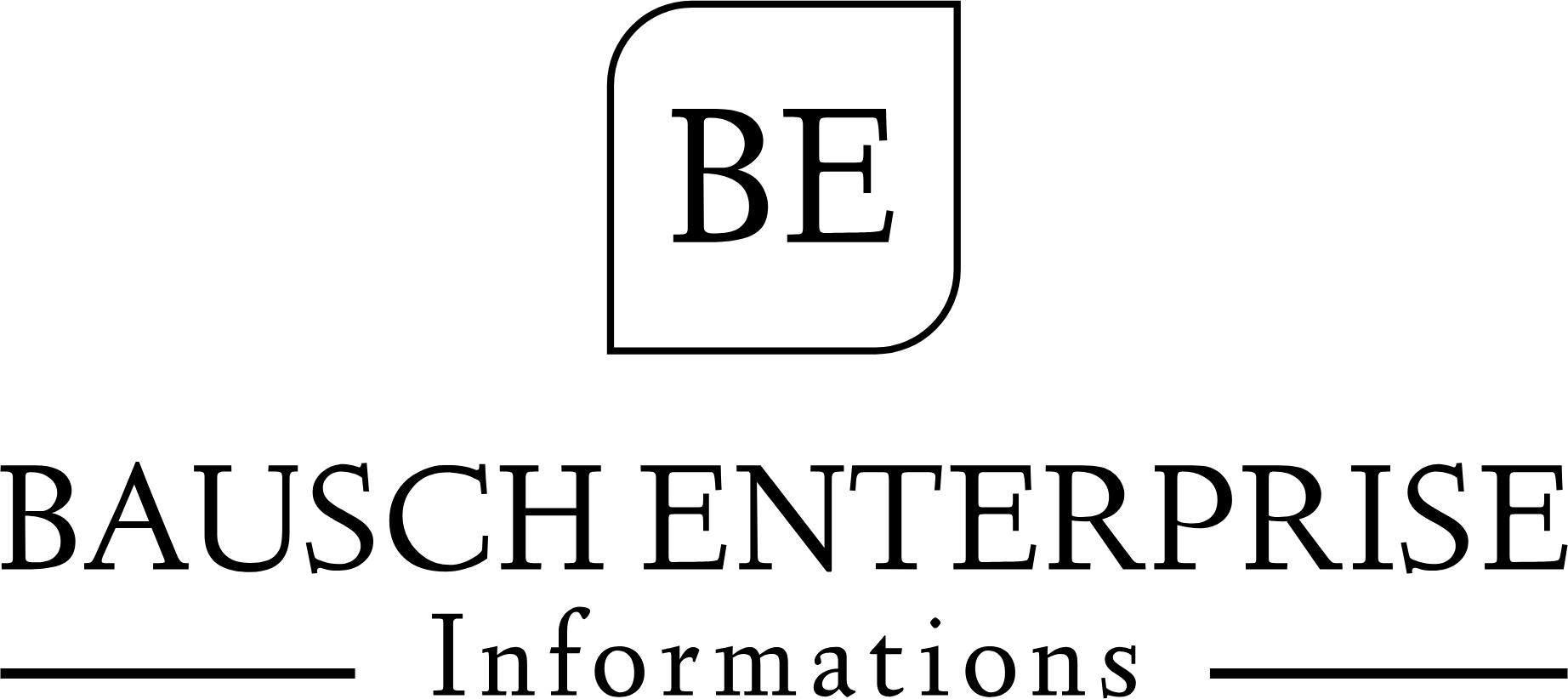Der Kollaps der FWU Life Insurance in Luxemburg hat wie ein Blitz eingeschlagen und er offenbart Baustellen und Risiken, die weit über diesen Einzelfall hinausgehen. Welche Herausforderungen der Fall FWU für die Versicherungsbranche und den Verbraucherschutz mit sich bringt. Warum konnte ein grenzüberschreitender Lebensversicherer überhaupt so in Schieflage geraten? Hat die Aufsicht früh genug gehandelt? Und welche Systemunterschiede zeigen sich beim Vergleich mit anderen Ländern? Sind die bestehenden Sicherungsnetze für Versicherte ausreichend? Wie wird das Vertrauen der Kunden durch solche Vorfälle erschüttert und was müssen Vermittler und Versicherer daraus lernen? Mit dem juristischen Blick auf aktuelle Entwicklungen, etwa die Debatte um die Rückabwicklung von Lebensversicherungen in Deutschland, die damit den Rahmen für Verbraucherschutz neu justiert.
Vertrauen und Transparenz in der Krise
Ein zentrales Problem, das die FWU-Pleite offenlegt, ist der Vertrauensverlust der Verbraucher. Lebensversicherungen gelten traditionell als sichere Anlage für die Altersvorsorge. Doch plötzlich sehen sich zehntausende Kunden in Europa mit der Realität konfrontiert, dass auch ein Lebensversicherer insolvent werden kann und man im Ernstfall jahrelang auf sein Geld warten muss. Dieses Szenario war für viele unvorstellbar. „Ich dachte, mein Geld wäre genauso sicher wie auf der Bank“, zitiert sinngemäß ein Betroffener. Hier zeigt sich eine Herausforderung: Versicherer und Vermittler müssen künftig noch transparenter kommunizieren, welche Risiken mit fondsgebundenen Policen verbunden sind. Heute wird kritisch betrachtet, dass vielen Kunden gar nicht bewusst war, bei einem ausländischen Versicherer abgeschlossen zu haben. Im FWU-Fall hatten zahlreiche Kunden aus Deutschland, Italien oder Frankreich Policen in Luxemburg, vermittelt über heimische Banken oder Berater. Juristisch stellt sich die Frage, ob hier Aufklärungspflichten verletzt wurden: Hätten die Vermittler deutlicher auf das andere Aufsichtsregime und die fehlende Zugehörigkeit zum deutschen Sicherungsfonds hinweisen müssen? Dieses Thema dürfte noch Anlass zu Streit geben. Verbraucheranwälte prüfen bereits mögliche Haftungsansprüche gegen Vermittler, insbesondere wenn den Kunden die Police als besonders sicher oder problemlos rückkauflos darstellte.
Grenzüberschreitende Aufsicht: Wer ist zuständig?
Der FWU-Fall hat auch die Tücken des europäischen Aufsichtsmodells offenbart. Nach dem Prinzip der Home Country Control ist für einen Versicherer immer die Aufsicht des Landes zuständig, in dem er seinen Sitz hat – hier also Luxemburg (CAA). Die BaFin in Deutschland oder andere nationale Behörden können bei einer Krise zwar mitwirken, haben aber keine direkte Eingriffsbefugnis, wenn der Versicherer nicht ihrer Gesetzgebung unterliegt. Im Sommer 2024, als FWU ins Straucheln geriet, mussten daher alle beteiligten Länder auf die Entscheidungen der Luxemburger Kollegen vertrauen. Die CAA ihrerseits koordinierte sich eng mit den Partnerbehörden und mit der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA, um einheitliche Informationen an die Öffentlichkeit zu geben. EIOPA veröffentlichte beispielsweise am 5. Februar 2025 eine Mitteilung in allen Sprachen, um die Policeninhaber über die Liquidation zu informieren und Ratschläge zu geben. Dennoch fühlten sich viele Kunden zunächst im Stich gelassen, vordergründig jene in Deutschland: Die BaFin erklärte zwar umgehend, dass sie nicht zuständig sei und Protektor nicht greife, richtete aber ein Servicetelefon ein. Im Nachhinein stellt sich die Frage, ob die europäische Abstimmung in solchen Fällen verbessert werden muss. Sollte es vielleicht klarere Mechanismen geben, um grenzüberschreitende Versicherer zu retten oder geordnet abzuwickeln, ohne dass Kunden in verschiedenen Ländern verunsichert sind? Hierzu passt, dass die EU-Kommission Ende 2023 an einem Versicherungs-Abwicklungsrahmen arbeitete. Aus Verbrauchersicht ist jedenfalls die Herausforderung, sich im Ernstfall im „Aufsichts-Dschungel“ zurechtzufinden. Die FWU-Insolvenz hat gezeigt: Wer seinen Vertrag bei einem ausländischen Versicherer hat, muss im Krisenfall auf fremdes Recht vertrauen. Für manche deutsche Kunden war es z.B. überraschend, dass kein deutscher Insolvenzverwalter zuständig ist und sie ihre Forderung in Luxemburg anmelden müssen. Diese Realitäten rücken nun stärker ins Bewusstsein und könnten die Nachfrage nach heimischen Versicherungsprodukten wieder erhöhen – was aus Marktsicht eine interessante Wendung wäre.
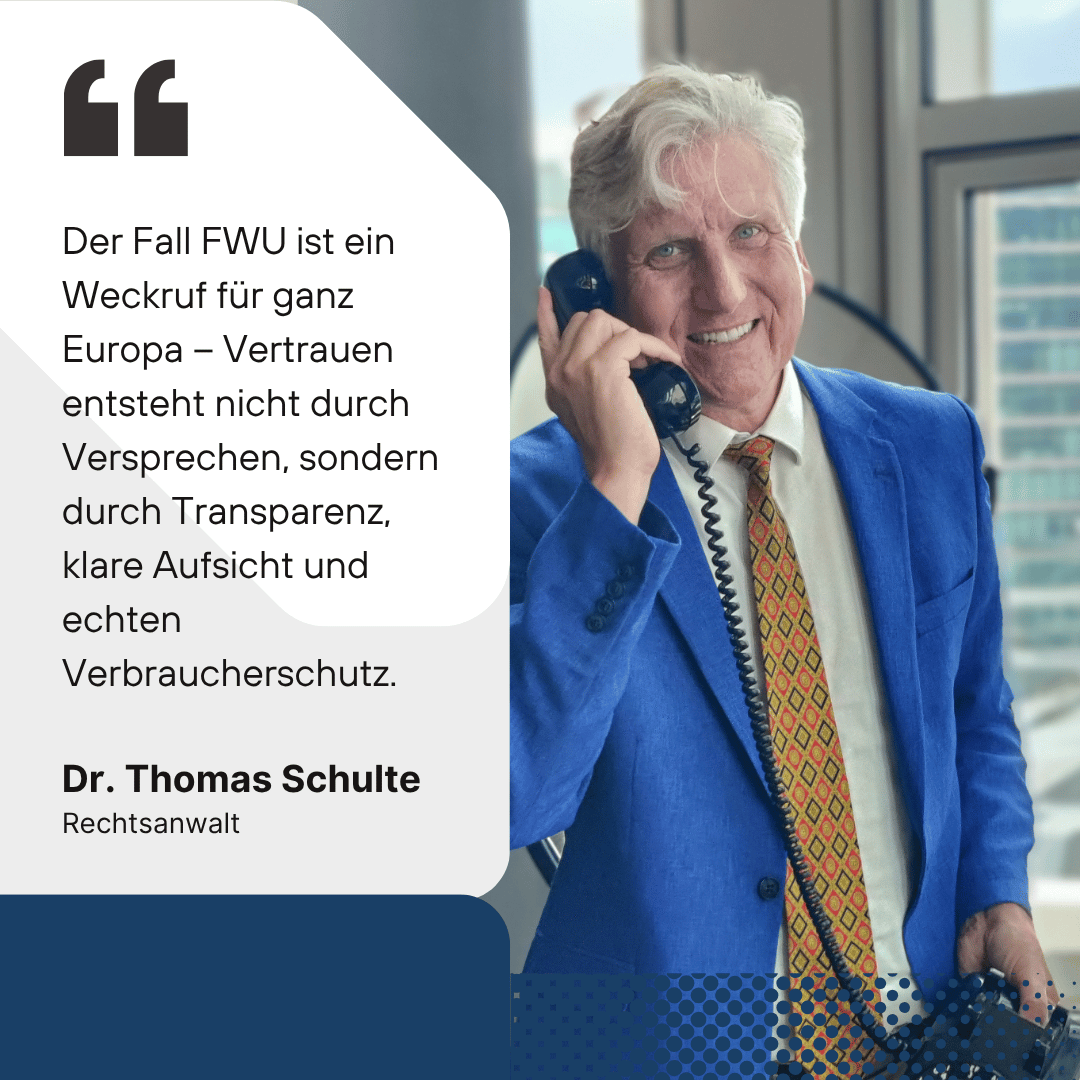
Sicherungssysteme im Vergleich
Eine weitere Herausforderung ist die uneinheitliche Absicherung der Kunden in Europa. Ein Blick in andere Länder zeigt unterschiedliche Strategien bei strauchelnden Lebensversicherern:
- Deutschland: Hier existiert seit 2002 der Sicherungsfonds Protektor als Auffanglösung für insolvente Lebensversicherer. Gerät ein deutscher Lebensversicherer in Not, übernimmt Protektor in der Regel den gesamten Bestand und führt die Verträge fort, sodass kein Kunde seinen Versicherungsschutz verliert. Ein historisches Beispiel ist die Mannheimer Lebensversicherung, deren Bestand 2003 von Protektor übernommen wurde und weitergeführt werden konnte. Im FWU-Fall hilft dieser Anker nicht, Luxemburg fällt nicht unter das deutsche Sicherungssystem, entsprechend blieben FWU-Kunden in Deutschland ohne Protektor-Rettung. Diese Lücke hat vielen erstmals bewusst gemacht, dass der Schutz von Lebensversicherungen nicht EU-weit einheitlich ist. Einige Stimmen fordern nun, zumindest für grenzüberschreitend tätige Versicherer bessere Absprachen oder einen europäischen Sicherungsmechanismus zu etablieren. Kritiker wenden ein, dass dies die funktionierenden nationalen Systeme verwässern könnte. Hier prallen also unterschiedliche Auffassungen aufeinander: nationales vs. europäisches Auffangnetz. Die Politik hat diese Herausforderung erkannt – dass die EU just zum Jahreswechsel 2024/25 eine neue Richtlinie zur Versicherungsabwicklung beschlossen hat, ist kein Zufall.
- Liechtenstein: Der Fall eines in Schieflage geratenen Lebensversicherers wurde 2019 im Fürstentum Liechtenstein auf besondere Weise gelöst. Dort verfügte die Finanzmarktaufsicht (FMA) im Februar 2019 kurzerhand die zwangsweise Übertragung sämtlicher Verträge der Wealth-Assurance AG und Valorlife AG auf einen gesunden Versicherer, nämlich die Skandia Leben (FL) AG. Hintergrund waren zwar keine akuten Solvenzprobleme, aber Bedenken gegen die Eigentümer der beiden Gesellschaften, welche nicht mehr als zuverlässig galten. Bereits ab 2016 hatte die FMA dort Sonderbeauftragte eingesetzt, die faktisch die Kontrolle übernahmen. Als keine Besserung eintrat, zog die Aufsicht die Reißleine: Rund 3.000 Policen mit einem Vermögenswert von etwa 3,6 Milliarden CHF wurden per Bescheid auf Skandia übertragen. Die Versicherten behielten durch diese Bestandsübertragung nahtlos ihren Versicherungsschutz; ihre Verträge liefen unverändert bei Skandia weiter. Skandia übernahm sogar 30 Mitarbeiter der alten Gesellschaften, sodass die Kunden weiterhin dieselben Ansprechpartner hatten. Unmittelbar nach Vollzug entzog die FMA den ursprünglichen Unternehmen die Lizenz. Dieser Ansatz – problematische Versicherer frühzeitig vom Markt zu nehmen und die Kundenbestände auf stabile Unternehmen zu übertragen – wird als vorbildlich angesehen, da er die Interessen der Versicherten optimal wahrt. Allerdings setzt er voraus, dass ein aufnahmefähiger Versicherer bereitsteht und die Aufsicht rechtzeitig interveniert. Im FWU-Fall war die Krise offenbar bereits zu weit fortgeschritten; eine solche Transfer-Lösung wurde jedenfalls nicht öffentlich diskutiert. Hier zeigt sich eine Herausforderung: Sollte die Aufsicht häufiger früh durchgreifen und notfalls Bestände zwangsweise übertragen, statt ein langes Insolvenzverfahren in Kauf zu nehmen? Der Liechtensteiner Weg hat jedenfalls bewiesen, dass dies machbar ist – und für die Kunden die wohl beste Lösung darstellt.
- Österreich: Österreich war vom FWU-Debakel insofern berührt, als es eine eigenständige Tochtergesellschaft, FWU Life Insurance Austria AG, gibt. Diese war jedoch solvent und blieb von der Insolvenz der deutschen Holding unberührt. Die FMA Österreich ergriff vorsorgliche Maßnahmen: Sie untersagte FWU Austria ab Juli 2024 jedes Neugeschäft, um das Unternehmen zu stabilisieren und Liquiditätsabflüsse zu vermeiden. FWU Austria verwaltet etwa 38.000 Verträge mit rund 880 Mio. € Fondsvolumen (Stand Mitte 2024). Alle diese Verträge, vorwiegend fondsgebunden, liefen normal weiter, da FWU Austria weiterhin alle Eigenmittelanforderungen erfüllte. Hier zeigte sich die strikte Trennung innerhalb einer Gruppe: Während die Luxemburger Schwester unterging, blieb das österreichische Unternehmen solide. Die Herausforderung besteht hier in der Kommunikation gegenüber Kunden: Manche österreichische FWU-Kunden waren verunsichert, ob ihre Policen noch sicher seien, obwohl nur das Auslandsgeschäft betroffen war. Die FMA konnte diese Verunsicherung durch Transparenz teilweise auffangen. Es zeigt sich aber ein generelles Problem: Versicherungsgruppen, die über Grenzen hinweg agieren, können in der öffentlichen Wahrnehmung „in Sippenhaft“ geraten, wenn ein Teil ins Straucheln gerät. Das verlangt von Aufsehern und Unternehmen ein geschicktes Informationsmanagement, um Vertrauen zu erhalten.
Drei Schwachstellen, ein Weckruf – was Lebensversicherer jetzt besser machen müssen
Aus all diesen Facetten lassen sich mehrere Herausforderungen und Lehren herausarbeiten:
Erstens wurde deutlich, dass Solvenzprobleme in Niedrigzins- und Krisenzeiten auch vormals erfolgreiche Geschäftsmodelle treffen können. FWU spezialisierte sich auf fondsgebundene Policen, die in den 2000er Jahren boomen, aber hohe Kosten und lange Laufzeiten hatten. Marktbeobachter merken an, dass die anhaltend niedrigen Zinsen und volatile Märkte solche Produkte unter Druck setzen – die erwarteten Renditen blieben aus, die Kündigungsquoten stiegen. Dies könnte bei FWU zu Liquiditätsengpässen beigetragen haben. Für die Branche heißt das: Nachhaltigkeit der Produkte ist wichtiger denn je. Versicherer stehen vor der Herausforderung, Produkte so zu gestalten, dass sie auch ungünstige Marktphasen überstehen, ohne dass gleich die Solvenz gefährdet ist. Das umfasst etwa moderatere Kostenstrukturen, realistischere Projektionen und gegebenenfalls einen stärkeren Risikopuffer im Eigenkapital.
Zweitens zeigt der Fall, dass die Kommunikation im Krisenfall zur Herausforderung wird. FWU-Kunden beklagten sich über mangelnde Information unmittelbar nach dem Moratorium. Viele erfuhren erst Wochen später durch Zufall, warum ihre Auszahlungsanträge plötzlich nicht bearbeitet wurden. Hier muss die Branche besser werden: Ein frühzeitiges, offenes Krisenmanagement mit klaren Ansagen (auch unangenehmen) ist nötig, um Vertrauensschäden zu begrenzen. Im FWU-Fall kam erschwerend hinzu, dass die IT-Abschaltung durch die Muttergesellschaft die Kommunikation lahmlegte. Juristisch betrachtet war dieses Vorgehen der FWU AG höchst fragwürdig – die Aufseher dürften prüfen, ob dadurch gegen kooperative Pflichten gegenüber der Tochter verstoßen wurde. Für zukünftige Krisenszenarien sollten Versicherer Vorsorge treffen, etwa alternative Kommunikationswege oder vertragliche Regelungen innerhalb von Konzernen, um einen geordneten Informationsfluss sicherzustellen. Die CAA hat in diesem Punkt vorbildlich reagiert und schnell eigene Kanäle geschaffen. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, alle betroffenen Kunden rasch zu erreichen und zu betreuen.
Drittens wirft die FWU-Insolvenz Schlaglichter auf eine in Deutschland viel diskutierte Thematik: die Rückabwicklung von Lebensversicherungen. Bereits vor der Insolvenz gab es etliche FWU-Kunden, die ihre Verträge loswerden wollten. Sei es wegen Unzufriedenheit mit der Performance oder aufgrund des sogenannten „Widerrufsjokers“. In ganz Europa, speziell aber in Deutschland und Italien, waren FWU-Policen oft über freie Vermittler als Sparplan verkauft worden. Nicht wenige Kunden fühlten sich im Nachhinein falsch beraten, weil die Verträge hohe Kosten und lange Laufzeiten hatten. In Deutschland gibt es seit einem richtungsweisenden BGH-Urteil 2014 die Möglichkeit, Lebensversicherungen (insbesondere Verträge von 1994 bis 2007) rückabzuwickeln, wenn die Widerspruchsbelehrung fehlerhaft war. Dieses „ewige Widerrufsrecht“ haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Anleger genutzt, um aus unrentablen Policen auszusteigen und oft einen Mehrbetrag gegenüber dem Rückkaufswert zu erhalten. Für die Versicherer war das natürlich eine Belastung. Es drohten nachträgliche Auszahlungen, die nicht einkalkuliert waren. Nun kommt die FWU-Pleite und entzieht vielen Kunden die Möglichkeit, noch regulär zu kündigen oder zu widerrufen; stattdessen müssen sie auf die Liquidation hoffen. Interessanterweise hat die deutsche Bundesregierung kürzlich beschlossen, dieses ewige Widerrufsrecht einzuschränken: Ab Juni 2026 erlischt ein Widerrufsrecht trotz fehlerhafter Belehrung spätestens 24 Monate und 30 Tage nach Vertragsschluss. Nur wenn gänzlich keine Belehrung erfolgte, bleibt es unbegrenzt. Dieses neue Gesetz, Verabschiedung im September 2025, wird von Verbraucherschützern kritisch gesehen, da es einen wichtigen Hebel für Kunden beschneidet, während Versicherer aufatmen, weil die „Widerrufswelle“ gebremst wird.
Die FWU-Insolvenz führt vor Augen, dass Verbraucherschutz und Versichererinteressen hier im Spannungsfeld stehen: Einerseits soll kein Kunde ewig alte Verträge kippen können, andererseits zeigte sich aber, dass gerade in Fällen von Fehlentwicklungen (wie teuren Fondsversicherungen) der Widerruf ein Ventil für unzufriedene Kunden war. Zukünftig wird diese Option nur noch eingeschränkt bestehen – eine Herausforderung für Kunden, ihre Entscheidungen gut abzuwägen, und für Versicherer, durch bessere Produkte gar nicht erst solche Widerrufs-Anreize zu liefern.
Wenn das Sicherheitsversprechen bröckelt – Europas Versicherungswelt auf dem Prüfstand
Alles in allem hat die Causa FWU Life Insurance zahlreiche Schwachstellen aufgedeckt: Die europäische Aufsichtskooperation wurde einem Stresstest unterzogen, die Kommunikation mit Verbrauchern in der Krise erwies sich als verbesserungswürdig, die Produktgestaltung mancher Lebensversicherer als anfällig, und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Vertragsrücktritte stehen im Wandel. Für die Branche bedeutet dies, sich diesen Herausforderungen aktiv zu stellen. „Wie sicher sind die Gelder in Lebensversicherungen wirklich?“ – diese Frage stellen sich nun viele Verbraucher mit neuer Skepsis. Die ehrliche Antwort muss lauten: Sie sind so sicher, wie das Regulierungsregime des Landes, in dem der Versicherer sitzt, es vorsieht. Luxemburg hat hier einiges zu bieten (Superprivileg, getrennte Kundengelder), aber auch das garantiert keine völlige Schmerzfreiheit, wie man sieht.
Autor: Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Thomas Schulte
Malteserstraße 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Dr. Thomas Schulte ist Rechtsanwalt mit Kanzleisitz in Berlin und seit 30 Jahren auf Bank-, Kapitalanlage- und Versicherungsrecht spezialisiert. Als Vertrauensanwalt des internationalen Kanzleinetzwerks ABOWI Law berät er Mandanten aus dem In- und Ausland in komplexen zivilrechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Bereich der Verbraucherrechte, Rückabwicklung von Lebensversicherungen sowie der Haftung von Vermittlern und Finanzdienstleistern. Dr. Schulte ist zudem als Fachautor und Referent tätig und hat sich durch zahlreiche Publikationen einen Ruf als kritischer Beobachter regulatorischer Entwicklungen im Finanz- und Versicherungssektor erarbeitet.