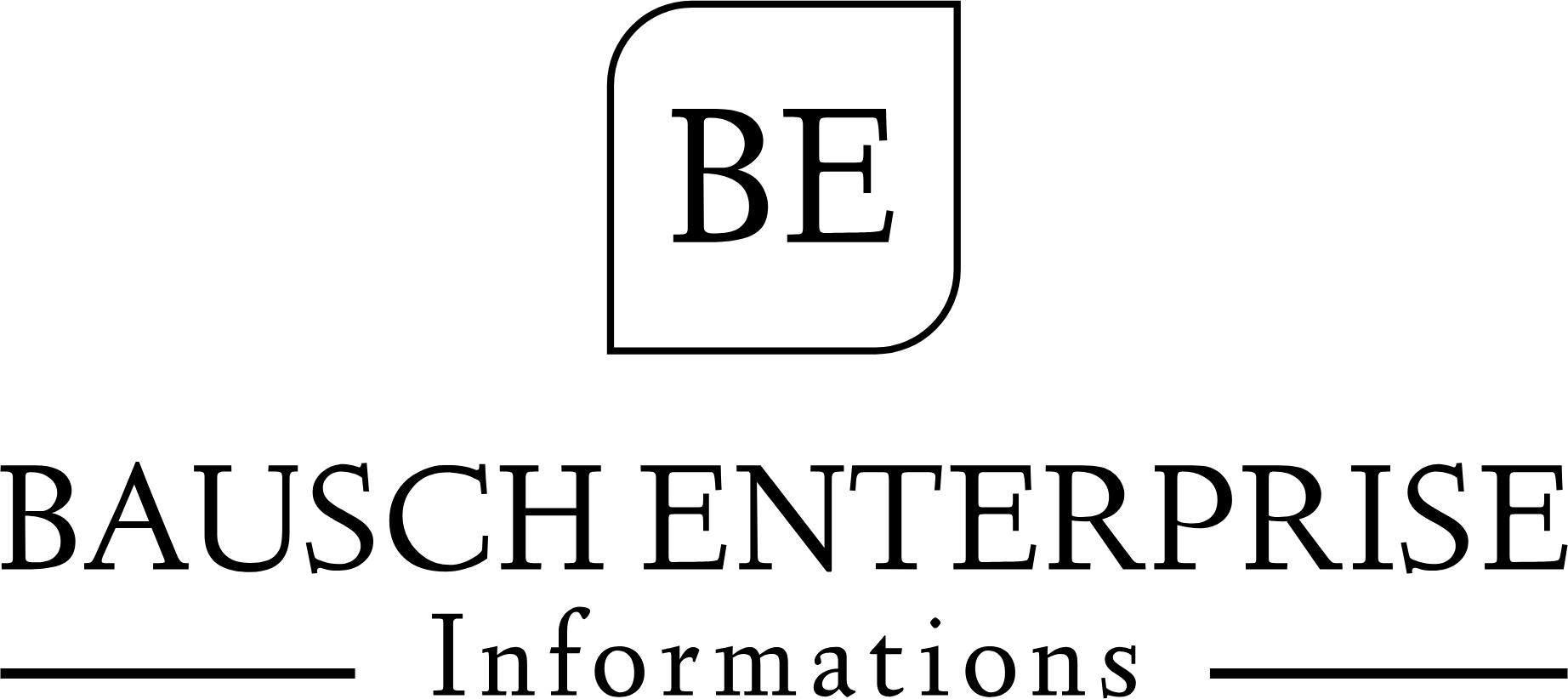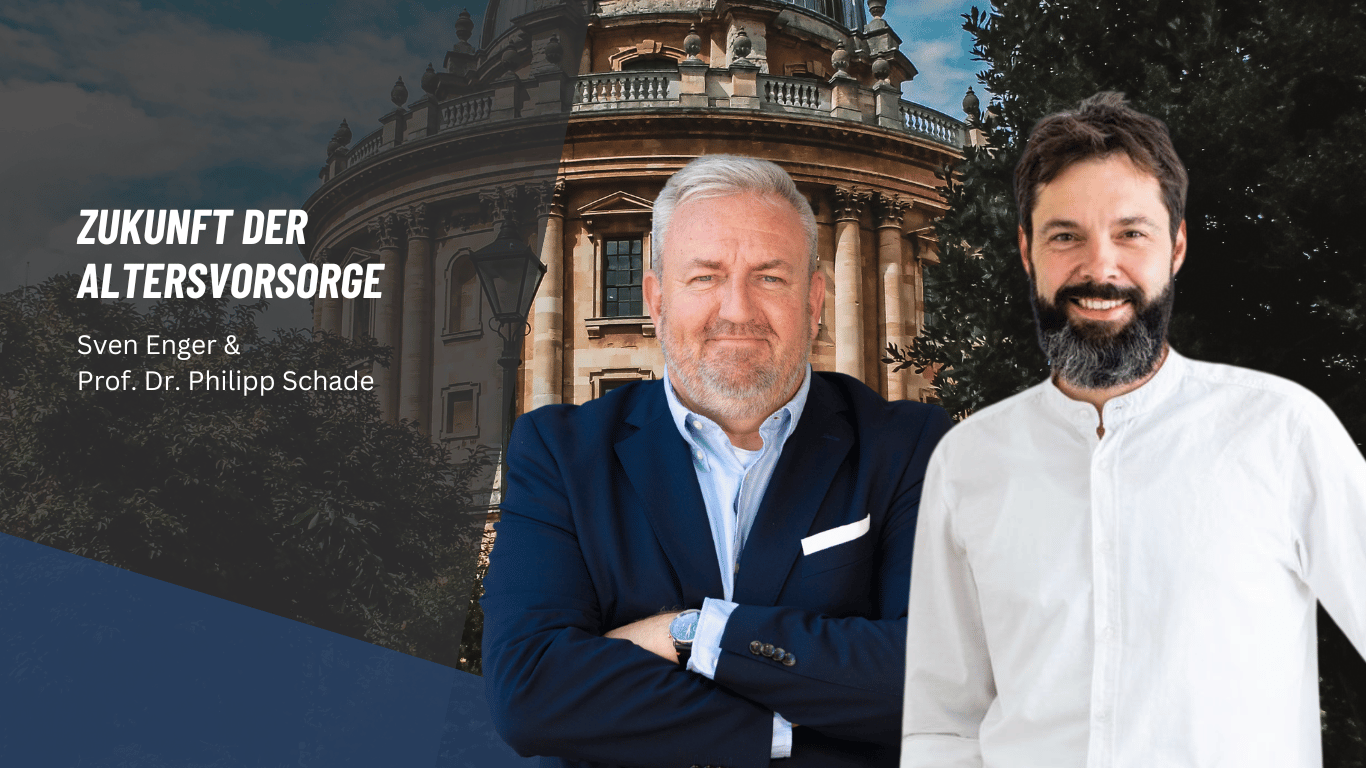Zwischen Ernüchterung und Aufbruch – welche Modelle taugen für eine faire und sichere Altersvorsorge?
Die deutsche Altersvorsorge steht an einem Scheideweg. Während Millionen Menschen noch immer auf klassische Lebens- und Rentenversicherungen vertrauen, wächst gleichzeitig die Zahl derer, die Verträge kündigen oder gar nicht erst abschließen. Verbraucher fühlen sich enttäuscht, zu wenig informiert und durch hohe Kostenstrukturen benachteiligt. Experten wie Sven Enger, ehemaliger Versicherungsvorstand und heutiger Geschäftsführer der auxinum GmbH, sowie Prof. Dr. Philipp Schade, unabhängiger Aktuar, sind sich einig: Ohne grundlegende Reformen bleibt die Altersvorsorge ein Flickenteppich, in dem die Interessen der Versicherten oft zu kurz kommen.
Die Bestandsaufnahme – ein System in der Vertrauenskrise
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verwalteten die deutschen Lebensversicherer 2024 Kapitalanlagen von rund 1.019 Milliarden Euro. Die Nettoverzinsung lag bei 2,37 Prozent – ein Wert, der zwar leicht über dem Vorjahr lag, aber angesichts einer Inflation von über 3 Prozent real ein Minusgeschäft bedeutete.
Noch deutlicher zeigt sich die Krise am Beispiel der Riester-Rente: Fünf Millionen Verträge wurden seit ihrer Einführung gekündigt, allein 220.000 in den ersten acht Monaten 2025. Von den verbliebenen 15,5 Millionen laufen viele nicht mehr aktiv. Was einst als „Rettungsanker“ für die Rentenlücke gedacht war, hat sich für Millionen Verbraucher zum teuren Irrtum entwickelt.
Juristisch betrachtet drängt sich die Frage auf: Hat die Politik ihre Schutzpflichten gegenüber Verbrauchern vernachlässigt, indem sie Modelle gefördert hat, die realwirtschaftlich kaum Rendite erwirtschaften konnten?

Sicherheit versus Rendite – ein unauflösbarer Widerspruch?
Die Versicherungsbranche verweist gern auf die Stabilität ihrer Produkte. Durch die strengen Vorgaben von Solvency II investieren Lebensversicherer überwiegend in festverzinsliche Anleihen, die zwar sicher, aber renditeschwach sind.
Sven Enger warnt aus seiner langjährigen Vorstandserfahrung: „Sicherheit und Rendite dürfen nicht in einen Topf geworfen werden. Wer Sicherheit verspricht, darf keine hohen Renditen suggerieren. Genau dieser Widerspruch hat das Vertrauen der Kunden nachhaltig beschädigt.“
Hier wird das Grundproblem sichtbar: Verbraucher wurden über Jahrzehnte mit dem Versprechen geworben, Sicherheit und Rendite seien gleichermaßen erreichbar. Faktisch jedoch zahlen die Kunden hohe Verwaltungs- und Abschlusskosten, während die Versicherer stabile Bilanzen vorweisen – die Versicherten aber mit minimalen Auszahlungen zurückbleiben.
Juristisch stellt sich die Frage, ob dies nicht in den Bereich irreführender Werbung (§ 5 UWG) oder Falschberatung (§ 280 BGB) fällt.
Verbraucherrechte im Fokus – Lehren aus der Riester-Krise
Die Riester-Rente gilt heute als Paradebeispiel gescheiterter Verbraucherpolitik. Hohe Kosten, geringe Renditen und komplizierte Förderstrukturen haben dazu geführt, dass Millionen Menschen ihre Verträge kündigen.
Prof. Dr. Schade bringt es aus aktuarieller Sicht auf den Punkt: „Die Mathematik ist unbestechlich. Ein Produkt, das systematisch mehr an Kosten erzeugt, als es an Rendite erwirtschaften kann, ist für den Verbraucher von vornherein eine Fehlkonstruktion.“
Die Lehre daraus: Verbraucherrechte müssen stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Transparente Kostenangaben, klare Widerrufsrechte und strenge Haftungsregeln für fehlerhafte Beratung sind juristisch zwingend.
Die Frühstartrente – Symbolpolitik oder echte Lösung?
Ab 2026 plant die Bundesregierung die Einführung einer sogenannten Frühstartrente: Jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren soll monatlich zehn Euro vom Staat in ein Vorsorgedepot erhalten. Über Jahrzehnte hinweg soll so ein Kapitalstock aufgebaut werden.
Finanzexperten von Finanztip haben kürzlich veröffentlicht, dass die sogenannte Frühstartrente in ihrer geplanten Form kaum mehr ist als Symbolpolitik. Hohe Kosten, Intransparenz und fehlende Renditechancen bestehen bleiben, wie soll ein staatlicher Zuschuss langfristig helfen? Diese Einschätzung wirft eine zentrale Frage auf, die weit über das Modell selbst hinausgeht: Wie sollen Verbraucher die Sicherheit ihrer Altersvorsorge einordnen, wenn politische Programme vorwiegend auf symbolische Effekte setzen, anstatt die grundlegenden Schwächen des Systems zu beseitigen?
Juristisch betrachtet bleibt offen, ob mit der Frühstartrente tatsächlich ein tragfähiger Beitrag zur Sicherung des Ruhestands geleistet wird oder ob es sich lediglich um ein weiteres politisches Projekt handelt, das zwar Schlagzeilen generiert, aber keine echte Entlastung bringt. Diskutiert werden müsste daher, wie ein solches Modell überhaupt rechtlich bewertet werden kann. Handelt es sich um einen ernst zu nehmenden Reformansatz, der durch klare Rahmenbedingungen gestärkt werden muss, oder lediglich um ein Instrument, das Bürgern eine Scheinsicherheit suggeriert? Genau an diesem Punkt wird deutlich, wie dringend eine offene Debatte nötig ist – nicht nur politisch, sondern auch rechtlich und gesellschaftlich.
Die Zahlen sprechen jedenfalls eine klare Sprache: Zehn Euro pro Monat, über zwölf Jahre hinweg eingezahlt, ergeben gerade einmal 1.440 Euro. Selbst bei optimistischer Renditeentwicklung reicht das nicht einmal annähernd aus, um im Alter eine Versorgungslücke zu schließen. Damit stellt sich die Frage: Reicht es aus, ein symbolisches Signal zu setzen, oder braucht es tiefgreifende Strukturreformen, die endlich Kosten deckeln, Transparenz schaffen und echte Renditechancen eröffnen?
Rechenbeispiel – die Rentenlücke bleibt dramatisch
Wer heute 35 Jahre alt ist, netto etwa 3.200 Euro verdient und im Ruhestand ab 67 Jahren zusätzlich rund 800 Euro pro Monat in heutiger Kaufkraft sichern möchte, benötigt überschlägig ein Kapitalpolster von ca. 240.000 Euro (Faustregel: Jahresbedarf × 25). Unterstellt man eine reale Rendite von 3 Prozent p. a. bis zur Rente, ergibt die Mathematik eine klare Hausnummer: Um diese 240.000 Euro bis 67 zu erreichen, wären rund 410 Euro monatlich nötig. Beginnt die Vorsorge erst mit 45, schrumpft der Ansparzeitraum auf 20 Jahre – die monatliche Last steigt dann auf etwa 730 Euro. Beide Beträge sind grobe Orientierungen, aber sie illustrieren die Größenordnung sehr deutlich: Der eigentliche Hebel liegt in frühem Beginn und laufend ausreichenden Beiträgen – nicht in symbolischen Zuschüssen. Zehn Euro staatlich pro Monat (à la Frühstartrente) mögen gut gemeint sein, doch sie verändern diese Grundrechenarten kaum. Die Herausforderung bleibt, kostengünstige, renditestarke und transparente Vorsorgelösungen zu nutzen, damit aus konstanten Einzahlungen tatsächlich ein inflationsfester Ruhestandsbaustein wird.

Juristische Baustellen – von der Beratung bis zur Rückabwicklung
Viele Verbraucher fragen sich: Kann ich aus meinem Vertrag überhaupt heraus? Die Antwort lautet: Ja – unter bestimmten Umständen.
Fehlerhafte Widerrufsbelehrungen können eine Rückabwicklung nach § 812 BGB ermöglichen. Auch Falschberatung durch Vermittler begründet Schadenersatzansprüche nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Die Rechtsprechung zeigt: Immer wieder gewinnen Verbraucher Prozesse, weil sie über Kosten und Risiken nicht korrekt aufgeklärt wurden.
Diese Entwicklung ist mehr als nur juristische Detailarbeit – sie ist ein Weckruf. Wenn ganze Produktgruppen immer wieder in Gerichtsverfahren münden, zeigt das die strukturelle Unvereinbarkeit mit dem Verbraucherschutz.
Zukunftsmodelle – wie Altersvorsorge neu gedacht werden kann
Wer das Vertrauen der Verbraucher zurückgewinnen will, darf sich nicht mit kosmetischen Korrekturen zufriedengeben. Es braucht ein radikales Neudenken, das die Altersvorsorge aus der Perspektive der Versicherten betrachtet und nicht länger durch die Brille der Versicherungsunternehmen. Im Zentrum steht die Frage: Wie können Sicherheit, Rendite und Transparenz tatsächlich in Einklang gebracht werden? Ein entscheidender Ansatzpunkt ist die Kostenstruktur. Heute fließen bei vielen Verträgen zwei bis drei Prozent der Beiträge allein in Verwaltung und Abschlussprovisionen. Finanzexperten und Verbraucherschützer fordern deshalb eine strikte Deckelung auf 0,5 Prozent im Jahr – nur so bleibt der Gedanke einer fairen Vorsorge realistisch.
Ebenso wichtig ist die Renditeorientierung. Jahrzehntelang wurden Verbraucher in Produkte gedrängt, deren Komplexität jede Vergleichbarkeit verhinderte und deren Renditeversprechen oft im Widerspruch zur Realität standen. Anstelle intransparenter Policen müssten künftig einfache, standardisierte ETF-Produkte gefördert werden, die kostengünstig und nachvollziehbar am Kapitalmarkt investieren. Diese Transparenz schafft nicht nur Vertrauen, sondern ermöglicht den Menschen erstmals, ihre Altersvorsorge zu verstehen und eigenständig zu bewerten.
Doch Vorsorge darf nicht starr sein. Die Zukunft verlangt Flexibilität, gerade bei den Auszahlungsmodellen. Verbraucher wollen entscheiden können, ob sie sich für eine lebenslange Rente, flexible Teilentnahmen oder sogar vererbbare Auszahlungen entscheiden – eine Wahlfreiheit, die das heutige System kaum bietet. Ein weiterer Schlüssel liegt in der breiten Beteiligung. Systeme, bei denen jeder automatisch einbezogen wird, es sei denn, er widerspricht – sogenannte Opt-out-Modelle – haben in anderen Ländern bereits gezeigt, dass sie die Sparquote signifikant erhöhen können.
Nicht zuletzt ist juristische Klarheit das Fundament einer zukunftsfesten Altersvorsorge. Strengere Haftungsregeln für Falschberatung, klare und verbraucherfreundliche Widerrufsrechte sowie eine Vereinfachung des Steuerrechts sind keine optionalen Extras, sondern unverzichtbare Grundlagen. Nur so lässt sich vermeiden, dass Verbraucher in einem undurchsichtigen Geflecht aus Kosten, Risiken und versteckten Klauseln verloren gehen.
Die Herausforderung ist also umfassend: Es geht um eine Architektur der Altersvorsorge, die sich nicht mehr an der Stabilität von Unternehmensbilanzen orientiert, sondern am Schutz der Menschen, die ihr Geld über Jahrzehnte anvertrauen. Alles andere wäre kein Fortschritt, sondern lediglich eine Fortsetzung der Fehler der Vergangenheit.
Internationale Vorbilder – was Deutschland lernen kann
Andere Länder zeigen, dass es auch anders geht. In Schweden etwa existiert ein staatliches Vorsorgedepot, in das automatisch Beiträge fließen, investiert in kostengünstige Fonds. In den USA sorgen 401(k)-Pläne für breite Beteiligung am Kapitalmarkt, während in den Niederlanden Betriebsrenten mit klaren Transparenz- und Sicherheitspflichten organisiert sind.
Deutschland dagegen verharrt im Streit um Riester-Nachfolgemodelle und Stückwerk-Reformen. Juristisch betrachtet wäre es höchste Zeit, ein klar strukturiertes, einfaches und verbraucherfreundliches Modell gesetzlich zu verankern.
Fazit – Verbraucherrechte als Schlüssel zur Zukunft der Altersvorsorge
Die Altersvorsorge in Deutschland befindet sich in einer Strukturkrise. Millionen Verbraucher fühlen sich getäuscht, Millionen Verträge wurden gekündigt, und das Vertrauen in klassische Modelle ist massiv erschüttert.
Prof. Dr. Schade: „Die Mathematik zeigt unmissverständlich, dass das System ohne Reformen nicht funktionieren kann.“ Sven Enger ergänzt: „Wir müssen Altersvorsorge vom Verbraucher her denken – nicht von den Bilanzen der Gesellschaften.“
Das bedeutet: Nur wenn Politik, Aufsichtsbehörden, Juristen und Verbraucher gemeinsam handeln, kann eine Altersvorsorge entstehen, die Sicherheit, Rendite und Transparenz vereint.
Die Zukunft der Altersvorsorge ist keine rein ökonomische Frage. Sie ist eine gesellschaftliche Bewährungsprobe. Ob die Politik den Mut hat, die notwendigen Reformen umzusetzen, entscheidet darüber, ob Verbraucher auch in Zukunft vertrauen – oder ob sie sich endgültig von der klassischen Altersvorsorge verabschieden.
Autor:
Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com